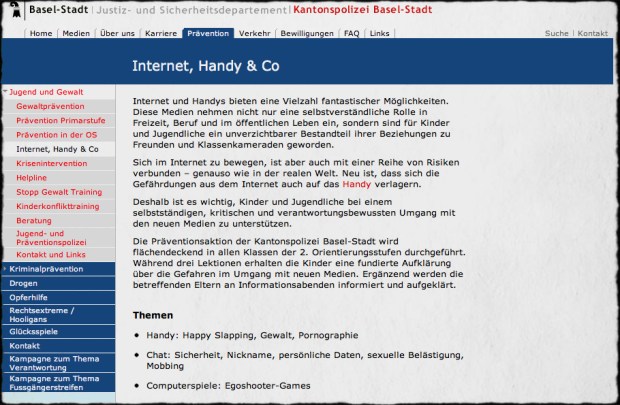Der folgende Beitrag versteht sich als Ausgangspunkt für die Gestaltung einer Unterrichtseinheit zum Thema »Shitstorm«. Das Thema würde ich in der Medienkunde ansiedeln, es eignet sich sehr gut, um Funktionsweisen von Social Media und von viralen Inhalten zu verstehen. Geeignet ist es für Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse.
Die einzelnen Teile könnten nach dem einführenden Video selbständig in Gruppen erarbeitet werden und z.B. auf einem Blog dokumentiert und zusammengeführt werden. Idealerweise informieren Schülerinnen und Schüler einander über die Ergebnisse ihrer Untersuchungen.
Einführung: Ein Video
Der Begriff »Shitstorm«
Der Begriff war 2010 als Anglizismus des Jahres nominiert und hat Eingang in Wikipedia und in den Duden gefunden. Dort steht als Definition:
Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium des Internets, der zum Teil mit beleidigenden Äußerungen einhergeht.
Die Frage, ob der Begriff tatsächlich eine Entlehnung aus dem Englischen ist oder im Deutschen eine neue Bedeutung erhalten habe, wird kontrovers diskutiert – auf jeden Fall handelt es sich um eine Form von Kritik, wie Susanne Flach festhält:
Kritik und Shitstorm mögen gemeinsam auf einem Protestkontinuum liegen; die Ausprägungen, Ausführungsorgane und Übermittlungskanäle sind aber unterschiedlich. Das wird auch daran liegen, dass mit steigenden Nutzerzahlen der sonst stammtischliche (hier: eben nicht aus traditionellen Medien abgefeuerter) Protest in den öffentlichen Raum getragen wird. Shitstorm fügt dem Kontinuum also einen Haltebereich hinzu – und gibt dem bisher ungehörten, aber neuerdings vokalisierbaren Unmut einen Namen.
Unterrichtsidee 1:
a) Die Geschichte des Begriffs selbständig recherchieren lassen.
b) Anglizismus und Scheinanglizismus begrifflich präzisieren lassen (als Forschungsaufgabe), mit Beispielen.
c) Wortfeld »Kritik« konstruieren lassen.
d) »Anglizismus des Jahres« rekapitulieren – welche Begriffe gewinnen und weshalb?
e) Welche Begriffe finden Aufnahme in den Duden/Wikipedia? Nach welchen Kriterien?
Perspektive 1: Shitstorm aus der Sicht des Opfers
Opfer eines Shitstorms ist meist eine Person des öffentlichen Lebens oder ein Unternehmen. Ein Beispiel:
Dirk Nowitzki, der deutsche Basketballsuperstar, hat einen Werbeclip für die ING-DiBa-Bank gedreht.
Dieses Video hat auf der Facebook-Seite der Bank für einen Sturm der Entrüstung gesorgt: Der Fleischkonsum von Nowitzki sowie die idealisierte Darstellung einer Metzgerei wurden harsch kritisiert, Kunden drohten mit der Auflösung ihres Kontos. Ein Shitstorm entwickelte sich, wie man hier nachlesen kann.
Die Frage ist nun, wie man aus der Sicht des Unternehmens oder aus der Sicht von Nowitzki auf dieses Problem reagieren kann. Expertinnen und Experten diskutieren eine Reihe von Strategien, einig scheint man sich darin zu sein, dass Zensur sehr problematisch ist: Löscht man kritische Kommentare, verstärkt sich der Shitstorm. Die Bank hat in diesem Beispiel die Welle der Kritik ausgesessen und – so scheint es – ihr Image dadurch verbessert.
Daniel Graf und Barbara Schwede haben bei Feinheit eine Shitstorm-Skala entwickelt, mit der man beurteilen kann, wann Kritik ein beängstigendes Ausmass annimmt:

Unterrichtsidee 2:
a) Beispiele für Shitstorms suchen und sie der Klasse vorstellen.
b) Beispiele mit der Skala beurteilen.
c) Reaktionsweisen von Community Managern skizzieren und vergleichen.
Perspektive 2: Shitstorm aus der Sicht der Kritisierenden
Daniel Graf hat sich auch die Frage gestellt, wie man denn einen Shitstorm starten kann. Aus dieser Sicht ist ein Shitstorm ein günstiges Mittel, um Aufmerksamkeit für ein Anliegen zu erhalten: Z.B. für eine NGO, die darauf aufmerksam machen will, dass Produkte unter Verletzung von Menschenrechten oder mit grossen Schäden für die Umwelt hergestellt werden. Graf hält folgende Tipps fest:
Unterrichtsidee 3:
a) Rechercheauftrag: Wie verbreiten sich Videos oder Bilder schnell in sozialen Netzwerken?
b) Diskussion: Sind Shitstorms ein legitimes Mittel für Kritik?
c) Praxis: Einen eigenen Shitstorm starten! [Die Warnung sei erwähnt: Lehrperson bewilligt Mittel und Inhalte…]
Update 20. August 2012: Im kleinen Rahmen habe ich eine Unterrichtseinheit dazu begonnen, das Arbeitsblatt kann man hier runterladen.