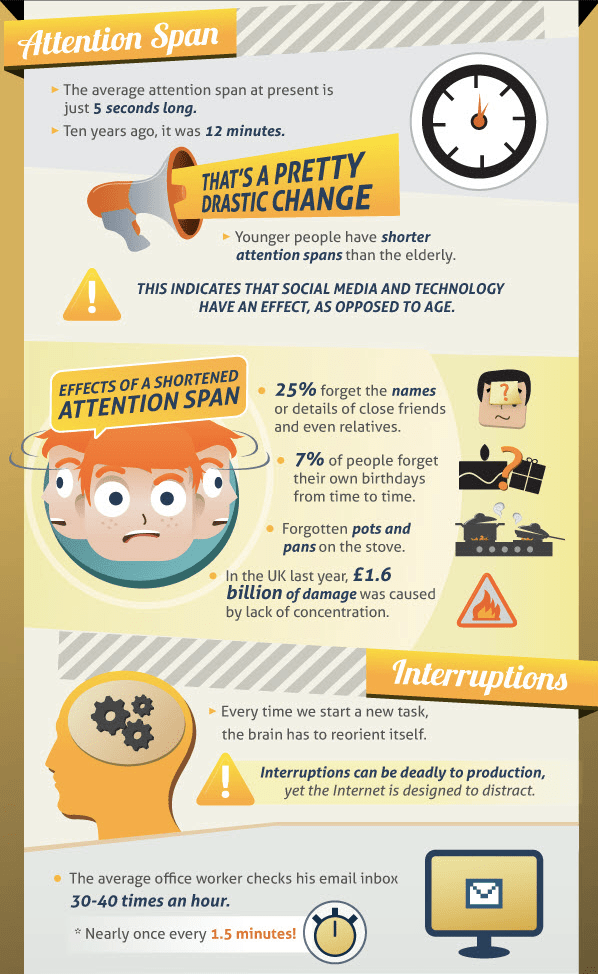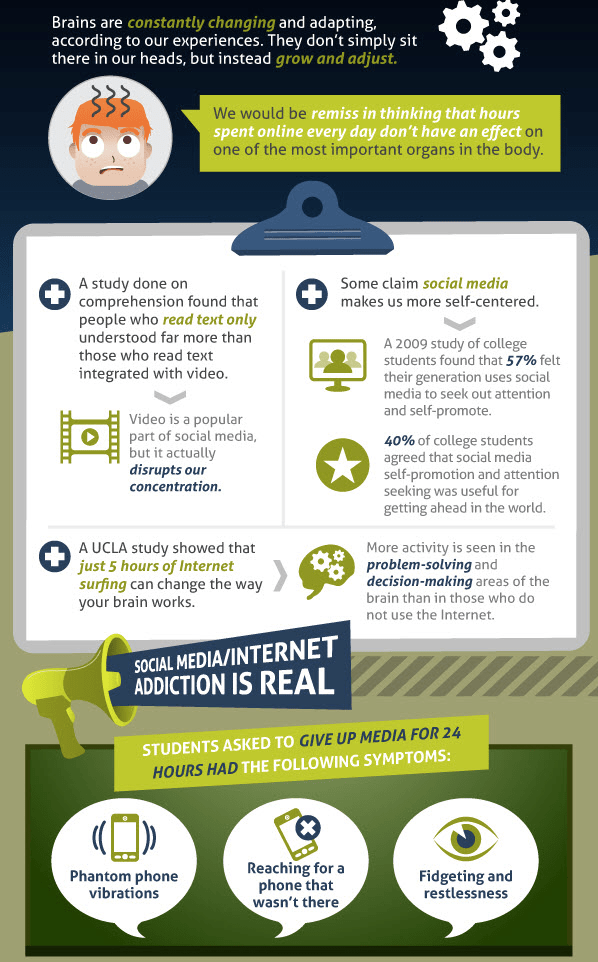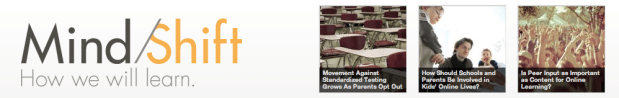Im Folgenden möchte ich das Thema »Trolle« in vier Schritten diskutieren: Zunächst kurz festhalten, was Trolle sind; danach über Trolle und Unterrichtssituationen sprechen und diese Diskussion dann spezifischer auf den Einsatz von Social Media im Unterricht zuspitzen; abschließend eine andere Perspektive auf Trolle als Künstler aufzeigen.
(1) Was sind Trolle
In einer Untersuchung von Online-Charakteren entwickelt Jonathan Bishop eine ethnographische Typologie von Verhaltensweisen in sozialen Netzwerken. Einer der Typen ist der Troll. Er ist dadurch charakterisiert, dass er chaotisch handelt und mit seinen Beiträgen vornehmlich versucht, Reaktionen zu provozieren. So hält der Wikipedia-Artikel fest:
Der Begriff Troll wird in der Netzkultur für eine Person verwendet, die mit ihren Beiträgen in Diskussionen oder Foren unter Umständen stark provoziert. Mutmaßliches Ziel des Trolls ist das Stören der ursprünglich an einem Sachthema orientierten Kommunikation und das Erlangen von Aufmerksamkeit.
In einem einflussreichen Essay bezeichnet Judith Donath das Trollen als ein »Spiel mit der Identität, das ohne die Einwilligung der meisten Spieler gespielt wird« und zitiert einen Forumseintrag, in dem ein Troll mit einem Fischer verglichen wird:
Trollen ist, wenn man eine Fischerrute ins Wasser hält und sie langsam hin- und herbewegt, um den Fischen den Köder vor die Nase zu halten. Trollen im Netzt funktioniert gleich – der Troll wirft einen Köder aus und wartet darauf, dass jemand zubeisst, um die anschließende Auseinandersetzung zu genießen. [Übersetzung phw]
Trolle werden gemeinhin als schädlich wahrgenommen, aus mehreren Gründen:
- Trolle stören Diskussionen nachhaltig.
- Trolle geben schlechte Ratschläge.
- Trolle verdrehen Fakten oder fälschen sie.
- Trolle verhindern den Aufbau von Vertrauen.
- Trolle erhöhen die Schwelle, die Fragende und Unwissende überschreiten müssen, um an Diskussionen teilnehmen zu können.
- Die Präsenz von Trollen birgt die Gefahr, dass jeder User als Troll wahrgenommen werden könnte.
Die gemeinhin vorgeschlagene Reaktion auf Trolle ist das Ignorieren: »Don’t feed a troll« ist eine klassische Regel in Foren – um in Donaths Bild zu bleiben: Nicht anbeissen, wenn man den Köder eines Trolls vor sich schwimmen sieht. Darüber hinaus ist es in vielen online Konversationsräumen möglich, Trolle auszublenden, so dass ihre Einwürfe nicht mehr sichtbar sind.

(2) Trolle im Unterricht
Wenn wir uns Unterricht vereinfacht als ein lehrergesteuertes Unterrichtsgespräch mit einer Klasse vorstellen, dann gibt es auch hier eine Reihe von Möglichkeiten, wie Trolle eine sachbezogene Diskussion stören können. Trolle wären bestimmte Schülerinnen und Schüler, die mit Wortmeldungen, Zwischenbemerkungen oder ihrem Verhalten »Köder« auswerfen.
Das ist kein neues Phänomen, insofern gibt es auch jede Menge didaktische Lösungen dafür, die hier nicht repetiert werden sollen und müssen. Generell liegt aber im Unterricht deswegen kein Trolling vor, weil die Identitäten klar sind. Allen Beteiligten ist klar, wer potentielle Trolle sind und wer nicht – deshalb ist die Bedrohung, die von Störefrieden ausgehen, viel kleiner. Niemand muss befürchten, als Troll wahrgenommen zu werden, wenn er oder sie sich nicht entsprechend verhalten hat; auch das Vertrauen kann nicht nachhaltig gestört werden, wenn einige Schülerinnen oder Schüler versuchen, den Unterrichtsverlauf zu beeinflussen und eine sachliche Diskussion zu verunmöglichen.
(3) Trolle beim schulischen Einsatz von Social Media
Daran anschließend kann man schnell zum Schluss kommen, das Problem könnte am einfachsten gelöst werden, wenn es keinen Freiraum für Identitäten gibt. Man müsste also, wenn Social Media-Tools für schulische Zwecke eingesetzt werden, darauf bestehen, dass Klarnamen verwendet werden, die eine Zuordnung zu einer »realen« Identität ermöglichen und so die Situation im Klassenraum in virtuelle Räume übertragen – zumindest in Bezug auf das Identitätsmanagement.
Damit ist aber auch eine gewisse Gefahr verbunden, wie ein Essay der Electronic Frontier Foundation zur Diskussion um die Klarnamenpflicht bei Google Plus zeigt:
Just as using „real“ names can have real consequences, mandating the use of „real“ names can too, excluding from the conversation anyone who fears retribution for sharing their views. While one added value of requiring real names might be increased „civility“ of the conversation, it is most certainly to the detriment of diversity.
[Übersetzung phw:] Genau wie »reale« Namen auch wirkliche Konsequenzen nach sich ziehen, kann der Zwang, »reale« Namen angeben zu müssen, Menschen ausschließen, die Angst haben, ihre Meinungen zu äußern. Während man als Nutzen eines Klarnamenszwangs den verbesserten Umgang angeben könnte, verhindert er sicherlich Diversität.
Auf den schulischen Kontext bezogen heißt das, dass abenteuerliche Meinungen, Kritik, Originalität eingeschränkt werden, wenn man gezwungen ist, seinen richtigen Namen anzugeben – während die Kontrolle der Lehrperson und der Umgangston generell besser ist.
(4) Der künstlerische Troll
In einem Essay von Astrid Herbold in der Zeit werden Trolle aus einer wohlwollenden Perspektive betrachtet:
Diese Schnelllebigkeit bewirke, dass beliebte Einträge immer wieder gepostet und variiert werden, stellte eine Untersuchung des Massachusetts Institut of Technology kürzlich fest. Das und die Anonymität förderten „das Experimentieren mit Ideen“ – weil das Scheitern für den Einzelnen folgenlos bleibt. Zündet eine schräge Pointe nicht, versucht man es eben mit der nächsten.
Stefan Krappitz [geht es eher] eher um die grundsätzliche Haltung. „Trolle wollen Spielregeln brechen und Erwartungen unterwandern. Deshalb kann man das Trollen durchaus als ein Mittel des künstlerischen Ausdrucks verstehen.“ […] Sein Definitionsvorschlag für kreatives Trollen: „Ein guter Troll belustigt nicht nur sich selbst, sondern viele Menschen.“
Diese positiven Eigenschaften, das Experimentieren mit Ideen, das lustvolle und belustigende Kommentieren, keine Angst vor dem Scheitern zu haben – das alles sind Elemente, die gutes Lernen begleiten. Und doch sind es gleichzeitig auch die chaotischen, destruktiven Kräfte, die in Cybermobbing münden können, wenn sich nämlich diese Energie gegen andere Menschen richtet.
Das Fazit wäre also Folgendes: In der Schule sollte es den Freiraum geben, sich von der eigenen Identität lösen zu können und das als etwas Lustvolles und Befreiendes zu erleben – aber innerhalb eines klar definierten Rahmens und Kontextes. Im generellen Einsatz von Social Media führt nichts an einer Klarnamenpflicht vorbei. Oder um es mit Postel’s Law zu sagen, das auf den Computerwissenschaftler Jon Postel zurückgeht: »Be conservative in what you do; be liberal in what you accept from others.« (Das Gesetz wird in diesem ausgezeichneten Troll-Artikel von Mattathias Schwartz im Magazin der New York Times zitiert.)
 Newman hat in Internationalen Beziehungen doktoriert und Beziehungen zwischen Nationen untersucht. Der Einbezug von Facebook hat drei Aspekte hervorgehoben, von welchen die Nähe der Beziehungen auf FB abhängt
Newman hat in Internationalen Beziehungen doktoriert und Beziehungen zwischen Nationen untersucht. Der Einbezug von Facebook hat drei Aspekte hervorgehoben, von welchen die Nähe der Beziehungen auf FB abhängt