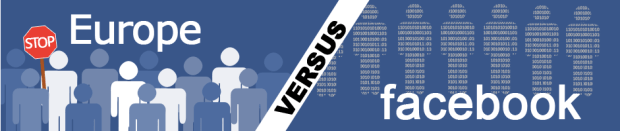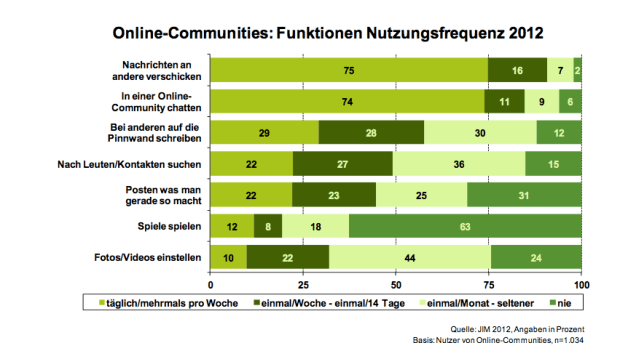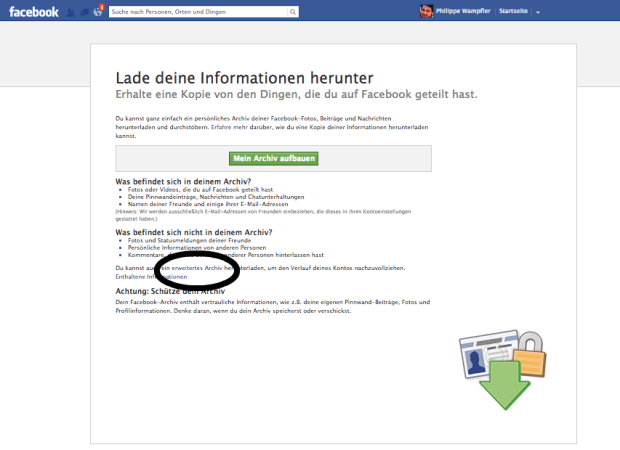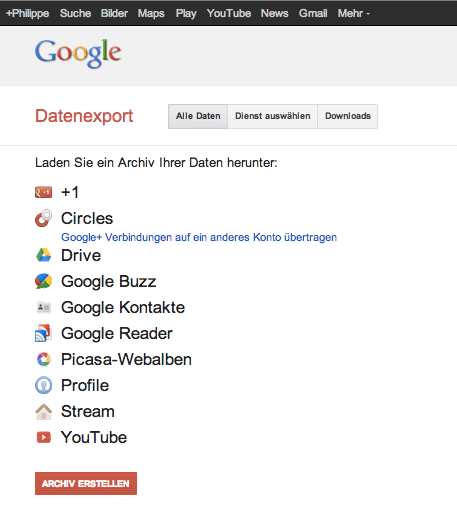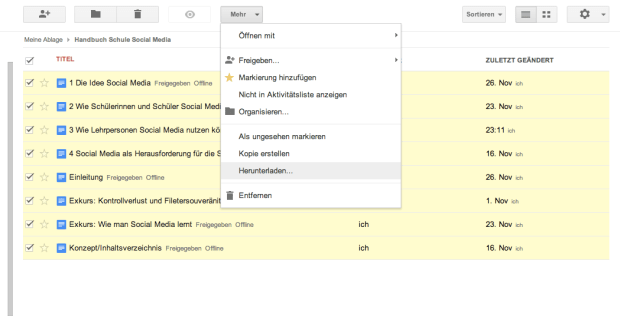Jugendliche bauen oft im öffentlichen Raum Gemeinschaften auf: In Shoppingzentren, auf Plätzen, in der Schule. Nur so kann ihr Verständnis von Privatsphäre verstanden werden. Im Folgenden einige Gedanken zum Umgang von Jugendlichen mit Privatsphäre – die hinter das Vorurteil zurückgehen, Jugendliche würden hemmungslos schützenswerte Inhalte publik machen.
Danah boyd versteht Privatsphäre nicht als juristisches Konzept, sondern als eine soziale Norm, die immer wieder neu ausgehandelt wird. Jugendliche kennen selten private Räume, sie teilen Zimmer oder müssen damit rechnen, dass ihre Eltern sich aus verschiedenen Gründen Zutritt zum Zimmer verschaffen. Diese grundlegende Erfahrung führt dazu, dass sie Privatsphäre als Kontrolle des Informationsflusses oder als Kontrolle der sozialen Situation verstehen. Privat sind für Jugendliche die Informationen, von denen sie bestimmen können, wer sie in welchem Kontext erhält und was damit geschieht. Jugendliche sind in Bezug auf ihre Privatsphäre mit paradoxen Verhaltensweisen der Erwachsenen konfrontiert: Einerseits beklagen sie, dass Jugendliche sich nicht um ihre eigene Privatsphäre kümmern würden und Informationen zu freizügig publizierten, andererseits verletzen sie die Privatsphäre von Jugendlichen systematisch, meist in der Absicht, sie zu schützen.
Dabei würde, so boyd, Zugänglichkeit und Öffentlichkeit verwechselt. Jugendliche haben klare Vorstellungen von Vertrauen und vom Umgang mit Informationen; ihre soziale Position sowie die Architektur von Netzwerken hindern sie aber oft daran, den Fluss von Informationen zu kontrollieren. Sie kommunizieren aber in einem für sie klaren Kontext, sie wissen, für wen Informationen oder Daten bestimmt sind und für wen nicht. Jugendliche entwickeln eine Art implizite Ethik des Informationsflusses, können sie aber oft nicht so umsetzen, wie sie das möchten, auch deshalb, weil es sich um Normen handelt, die sie nicht selbst bestimmen können. Man kann das mit einem analogen Beispiel verdeutlichen: Nur weil Eltern das Tagebuch ihrer Kinder lesen könnten, heißt das nicht, dass sie es lesen dürfen. Dasselbe gilt für soziale Netzwerke: Eltern zwingen ihre Kinder oft dazu, ihnen Zugang zu ihren Profilen zu gewähren; Lehrpersonen können den Facebook-Profilen ihrer Schülerinnen und Schüler oft Informationen finden, die klar privat sind. Wenn also Erwachsene sich Zugang zu privaten Informationen verschaffen können, dürfen sie diese Informationen nicht als öffentliche betrachten.
Die Verwechslung von Zugänglichkeit und Öffentlichkeit basiert auch auf technischen Möglichkeiten: Auch in analogen Gesprächen wäre es möglich, private Informationen öffentlich zu machen, aber es würde erstens soziale Normen verletzen und ist zweitens technisch schwierig zu bewerkstelligen. Analoge Kommunikation ist im Normalfall privat und muss mit viel Aufwand öffentlich gemacht werden. Die Struktur der sozialen Netzwerke und die Absichten der Jugendlichen führen aber nach boyd dazu, dass das analoge Muster umgekehrt wird: Sie kommunizieren im Normalfall öffentlich und verwenden ihre Anstrengungen darauf, bestimmte Informationen auszuschließen und nur privat zugänglich zu machen. Die öffentliche Form der Kommunikation meint aber nicht, dass sie alle etwas anginge, sondern vielmehr, dass sie die etwas angeht, von denen innerhalb der bestehenden sozialen Normen erwartet werden kann, dass sie die Informationen zur Kenntnis nehmen.
Für Jugendliche ist es von großer Bedeutung, sichtbar zu sein. Sie sind sich auch bewusst, dass diese Sichtbarkeit mit Nachteilen verbunden ist, und verzichten deshalb auch darauf, alles sichtbar zu machen, sondern nur bewusst gewählte Inhalte. Das lässt sich am Umgang mit Bildern gut ablesen, die Jugendliche oft auf ihren Profilen publizieren, aber nur dann, wenn sie darauf so erscheinen, dass sie mit ihrer Erscheinung einverstanden sind. In der JAMES-Studie 2012 gaben fast 40% der Jugendlichen an, dass sie es schon erlebt haben, dass ohne ihre Zustimmung Bilder veröffentlicht wurden; wiederum rund 40% davon haben das als störend empfunden. Bilder entstehen in einem Kontext, soziale Normen legen fest, wie sie zugänglich gemacht werden dürfen. Nur weil Jugendliche sich oft digital zeigen, heißt das nicht, dass auch andere sie zeigen dürften oder ihre Inhalte weiterverbreiten dürfen. Jugendliche müssen ihr Auftreten, auch digital, selber bestimmen können. Die Verletzung der Privatsphäre erfolgt in diesem Bereich aber nicht durch Peers, auch Eltern veröffentlichen oft Bilder von Jugendlichen, ohne dafür eine Erlaubnis einzuholen.
Öffentliche Kommunikation erfordert zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Privatsphäre, die Jugendliche oft kunstvoll einsetzen oder gar erfinden. Es handelt sich um technische Möglichkeiten, aber auch um den Einsatz von Codes, von Täuschungen oder die Erfordernis von Vorwissen. So können beispielsweise Songtexte oft dazu dienen, eine Aussage zu machen, die nur Jugendliche, die den Song und seinen Kontext verstehen, entschlüsseln können. So ist es möglich, für alle sichtbar zu sprechen, die Bedeutung des Gesagten aber nur ausgewählten Adressatinnen und Adressaten zugänglich zu machen.