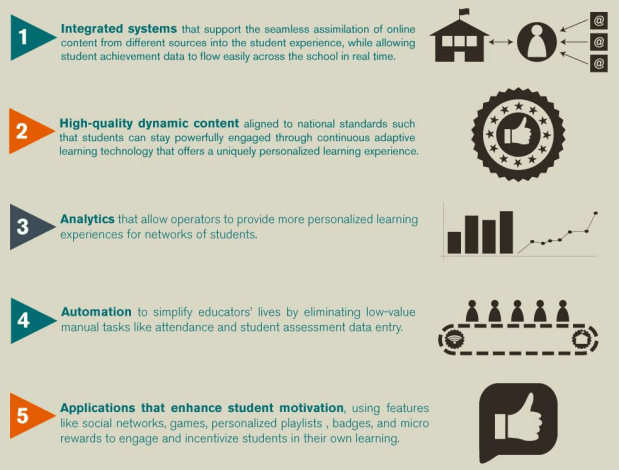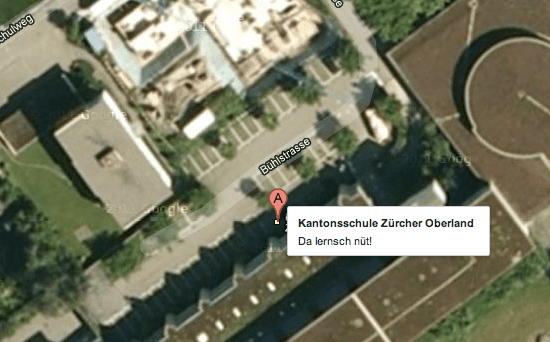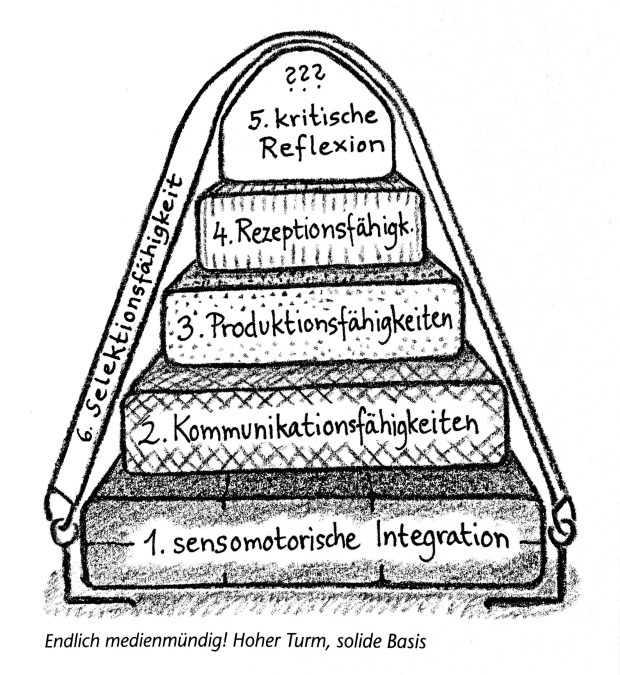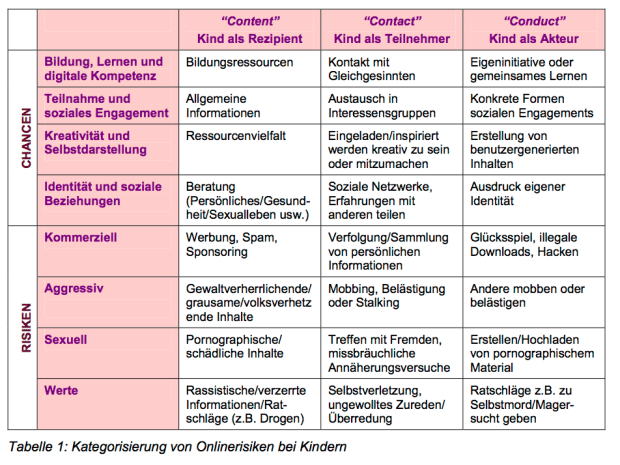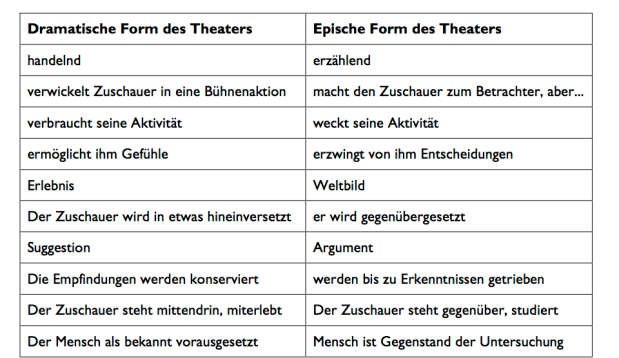Die amerikanische Literaturzeitschrift n+1 hat diese Woche einen Essay über Twitter publiziert (»Please RT«, verantwortlich dafür sind die Herausgeber). Darin findet sich eine Kurzkritik des Schreibens auf sozialen Medien – die deshalb bedeutsam ist, weil hier schon mehrfach über die Möglichkeiten des Einsatzes von Twitter im Schreib- und Literaturunterricht nachgedacht worden ist, z.B. hier und hier.
Der Artikel beginnt mit einer Beschreibung von Twitter – eine Beschreibung, die man kaum nachvollziehen kann, wenn man Twitter nicht aktiv nutzt, weil man sich dann fragt, wie Menschen sich ausdrücken können, wenn 140 Zeichen die Limite für jede Äußerung ist. Das kann nur ein bedeutungsloses Zwitschern sein, wie der Name Twitter es ausdrückt: Aber nichts, was den literarischen und kommunikativen Möglichkeiten des menschlichen Kulturlebens würdig wäre.
Wer jedoch einen Zugang zu Twitter findet, findet es plötzlich unterhaltsam und informativ. Man liest bei Zeugen von Katastrophen mit, Expertinnen in verschiedenen Wissensgebieten und Opinion-Leaders. Der Kreativität hinter Profilen scheinen kaum Grenzen gesetzt. Wenn man aber eine gewisse Distanz einnimmt, scheinen viele Tweets nur eins zu sagen:
I need to be noticed so badly that I can’t pay attention to you except inasmuch as it calls attention to me. I know for you it’s the same.
[Übersetzung phw:] Ich brauche so dringend Aufmerksamkeit, so dass ich mich dir nur dann zuwenden kann, wenn ich dadurch mehr Aufmerksamkeit generieren kann. Ich weiß, bei dir ist das gleich.
Und das stimmt: Obwohl es bei Twitter möglich ist, den Profilen zu folgen, die man interessant findet, halten es viele User so, dass sie das Verfolgen ans verfolgt Wenden knüpfen. Hört man auf, ihnen zu folgen, so hören sie auch auf, einem zu folgen.
Der Text zitiert die Schauspielerin Lena Dunham, Star der neuen HBO Serie »Girls«. Sie sagt in einem Interview auf die Frage, ob es in Bezug auf die Möglichkeiten, sich auf Social Media zu präsentieren, einen Unterschied zwischen den Generationen gäbe:
[M]y dad finds Twitter just infinitely unrelatable. He’s like, „Why would I want to tell anybody what I had for a snack, it’s private?!“ And I’m like, „Why would you even have a snack if you didn’t tell anybody? Why bother eating?“
[Übersetzung phw:] Mein Vater findet Twitter unmöglich. Er sagt: »Warum würde ich jemandem erzählen wollen, was ich gegessen habe, das ist doch privat?!« Und ich antworte: »Warum sollte ich überhaupt etwas essen, wenn ich nicht jemandem davon erzählen könnte?«
Twitter ermöglicht es, völlig Belangloses mitzuteilen, sogar, wenn es kryptisch ist. Es lässt Menschen reden, die nichts zu sagen haben, aber etwas sagen wollen. Das tun sie automatisch und sind davon besessen. Es kann, so die Herausgeber von n+1, sehr unterhaltsam sein, auf Twitter in Rollen zu sprechen, Figuren sprechen zu lassen. Aber Twitter verleitet Menschen dazu, selbst zu solchen Figuren zu werden, die nur noch auf eine bestimmte Art und Weise über ganz bestimmte Dinge schreiben können.
Diese Schreibweise betten die Autoren nun in den Kontext eines generellen Schreibzerfalls ein: Die Demokratisierung und Kostenlosigkeit von digitaler Produktion führe dazu, dass Texte publiziert würden, die früher in der Schreibtischschublade oder auf der Harddisk geblieben wären. Die forcierte Bloggerei führe dazu, dass ein relaxter Tonfall zum Muss werde, zur einzigen Ausdrucksform.
Betrachten wir ein Beispiel:
Schon bald wird ja „50 Shades of Grey“ auf Deutsch herauskommen und Sie überlegen sich vielleicht, es zu kaufen. Ich verstehe ja, dass Sie der ganze Hype neugierig macht, aber es ist wirklich unfassbar schlecht geschrieben und ausgedacht, so was sollte man sich nicht antun. Da kann die Übersetzung noch so gut sein, es bleibt Quatsch. Obwohl zu hoffen ist, dass zumindest grobe Schnitzer wie zum Beispiel „Laboutin“ (Sie wissen schon, die Schuhe mit der roten Sohle, bei denen alle Männer – und EL James – sofort eine Erektion kriegen, wenn sie sie sehen, weil die Schuhe inzwischen dermassen direkt verlinkt sind mit dem Gedanken „uh, ah, sexy“, dass die rote Sohle funktioniert wie der rote Arsch bei Pavianen) korrigiert wurden.
Michèle Roten verkörpert das, was die Herausgeber den »blogorrheic style« nennen: Den Stil der Blogorrhoe (Mischwort aus Blog und Logorrhoe). Die Geschwätzigkeit wird verbunden mit einer Vagheit – die in Kombination in der Lage zu sein scheint, authentische, wahre Texte zu produzieren.
Dagegen sei nun Twitter das Gegenmittel. Die Beschränkung auf 140 Zeichen produziere eine »Spracherweiterung durch formale Zwänge« – so das Ziel der Oulipo-Bewegung. So entstünden auf Twitter Sprachkunstwerke, Oscar Wilde oder Franz Kafka wären großartige Twitterer gewesen. Fazit: Die Leute entfolgen, die zu viel Unwichtiges verkünden und sich an John Berryman halten: