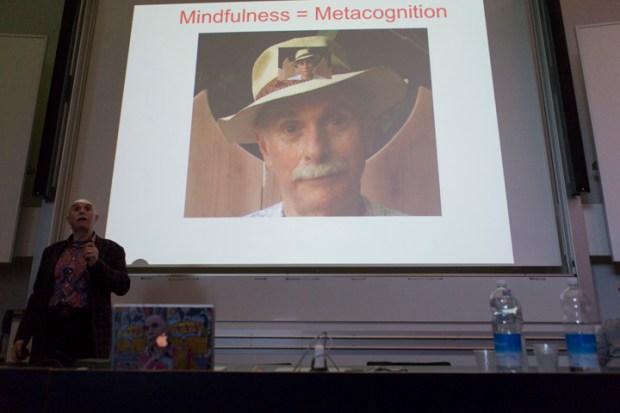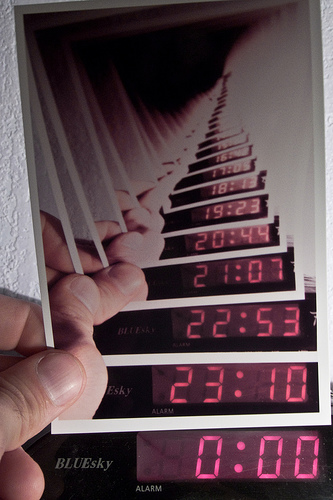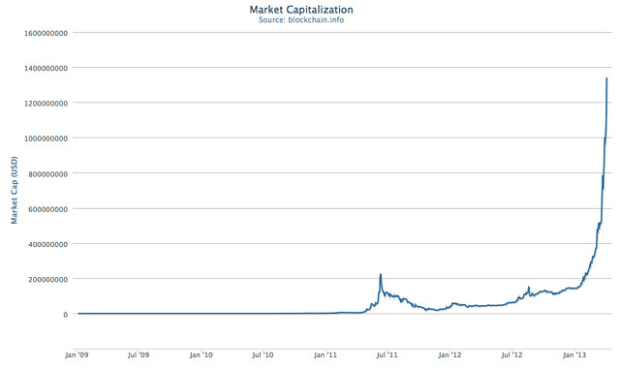Im Rahmen einer Blogparade lade ich ein, übers Lernen nachzudenken. Digitales Lernen verspricht aufgrund neuer technischer und medialer Möglichkeiten einen Wandel, der mir aber oft recht unklar erscheint, weil wir nicht genau verstehen, was sich eigentlich ändert oder ändern soll.
Als Ergänzung zu den Beschreibungen von Lerngschichten möchte ich hier eine theoretische Frage aufrollen, die in einem längeren Kommentarthread auf Google Plus von Rolf Todesco gestellt wurde:
[I]ch glaube ja sehr gerne, dass Du etwas gelernt hast, als Du gelernt hast Textverarbeitungsprogramme zu benutzen, ich weiss nur nicht, WAS Du dabei gelernt hast. Und noch weniger weiss ich, wie ich lernen könnte Texte zu schreiben. Schreiben ist immer Texte schreiben. Ich kann also nur das Schreiben lernen und dabei ist für mich ganz unklar WAS ich dabei lerne – vielleicht Buchstaben korrekt zu zeichnen? Es ist wie bei der Textverarbeitung, wo ich die richtigen Tasten verwenden muss.
Wer reden kann – und da weiss ich auch nicht, was lernen heissen soll – kann Aussagen machen, die er eben als Texts schreiben kann, wenn er schreiben kann. Was also kommt da noch hinzu? Auch die Vorstellung, dass man Denken lernen könnte (+Lisa Rosa) finde ich extrem komisch. Ich kennen keinen Menschen, der nicht denken kann. Denken ist wie reden oder gehen oder atmen.
Ich glaube, dass Ihr etwas viel spezifischeres meint, vielleicht nicht denken, sondern „so denken, wie Ihr denkt“ – und das müsste man dann vielleicht lernen, aber ich kann mir auch das nicht vorstellen.
An dieser Stelle könnten wir natürlich die Diskussion abbrechen und auf entsprechende lernpsychologische Literatur verweisen, die wissenschaftliche Begriffe von Lernen enthält. Diesen Weg möchte ich nicht gehen, weil ich gerade als Lehrer ja oft mit impliziten Annahmen darüber arbeite, was Lernen bedeuten könnte – und diese Annahmen kann man einerseits im Nachdenken über das eigene Lernen aufdecken, andererseits indem man sie zu formulieren versucht.
Welche Prozesse sind für mich mit Lernen verbunden:
- Varianten und Alternativen von Verhaltensweisen kennen lernen
- die Varianten beurteilen können und die beste wählen können
- die eigene Tätigkeit aus einer anderen Perspektive betrachten können
- Abkürzungen kennen, mit denen sich repetitive Arbeit vereinfachen lassen
- Form (Methoden) und Inhalt (Funktion) von Tätigkeiten bewusst aufeinander beziehen bzw. Form an den Inhalt anpassen oder Inhalt durch Form akzentuieren.
Rolf Todesco hat als Replik auf diese Formulierung die Begriffe Kennen und Können aufeinander bezogen:
Wie ich schon geschrieben habe, geht es um das kennenLERNEN. Und das Kennenlernen endet – dort von von Lernen die Rede ist – beim Können.
Ich habe Dich hier kennengelernt. Ich kenne Dich jetzt ein Stückweit. Das ist aber kein Können, also nehme ich dieses Kennenlernen nicht als Lernen. Wenn ich dagegen eine Textverarbeitung (also Dinger wie MS-Word) kennenlerne, dann endet das in einem Können, wo ich die Textverarbeiten sinnvoll verwenden KANN. Deshalb spreche ich hier von lernen, worin das Kennenlernen zum Können wird.
Lernen als Kennen Lernen, das zu einem Können wird finde ich als Formulierung passend: Die fünf oben erwähnten Punkte umfassen beide Dimensionen. Die praktische Frage ist dann wieder, in welchen Konstellationen Menschen bereit sind, Varianten für ihre Verhaltensweisen kennen zu lernen und daraus ein Können zu entwickeln. Meine Vermutung wäre, dass sowohl eine kreative Offenheit als auch eine fast zwanghafte Einengung beide Abläufe beschleunigen können.

In der achten Klasse hatte ich einen weit gefürchteten Französischlehrer. Wir lernten den subjonctif kennen und mussten alle Verben aufsagen können, die ihn verlangen. Das ging so: Wir erhielten vier recht dicht beschrieben DIN-A4-Seiten mit Listen und mussten die eine Woche später auswendig aufsagen können und zwar enorm schnell. Wir wurden in der Stunde abgefragt (»Philippe, Seite 3 unten, los!«) und erhielten direkt eine Note. So ging das einige Wochen. Das war vor mehr als 20 Jahren. Ich kann die Listen immer noch auswendig hersagen.
Dasselbe wäre wohl passiert, wenn ich zu dieser Zeit ein Jahr in Frankreich verbracht hätte. Im Gespräch hätte ich wohl zuerst ohne subjonctif auskommen müssen, hätte ihn dann aber wohl kennen und können gelernt – ohne Aufforderung, ohne Zwang.
Geändert hätte sich – das eine triviale Einsicht – wohl meine Motivation und meine Haltung zum Gelernten. Die Frage, wie ein Lernprozess bewertet werden soll (gibt es bessere und schlechtere, effizientere und weniger effiziente?), spare ich mir für einen nächsten Post auf.