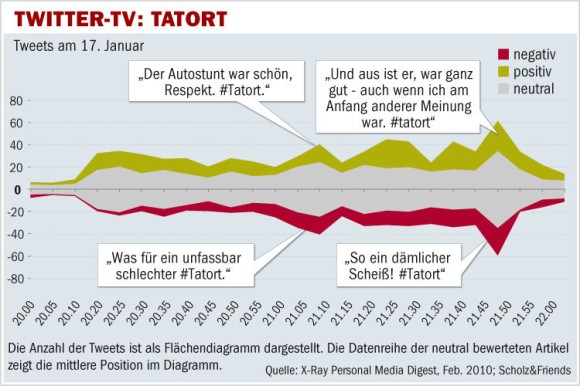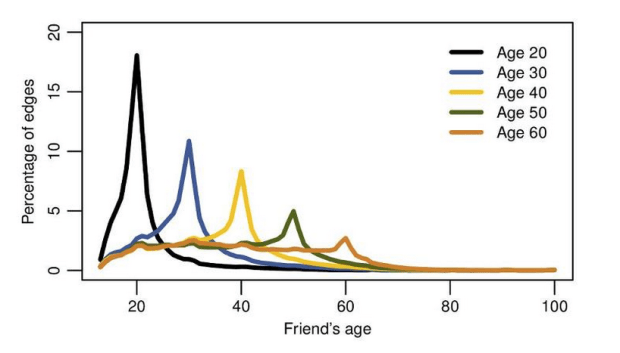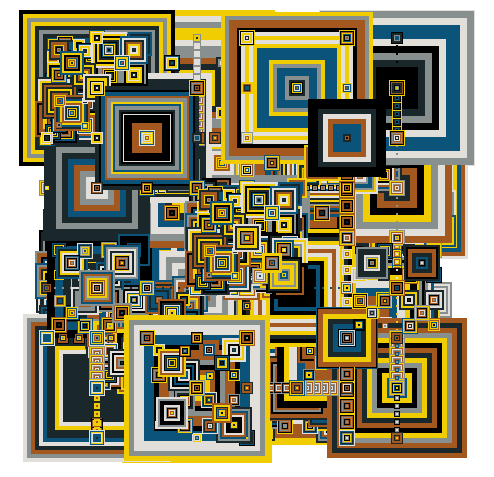Wie jede technische Innovation wurden auch die Möglichkeiten sozialer Vernetzung im Internet von Anfang an als Gefahr wahrgenommen. Fast zehn Jahre bevor Facebook erstmals im Netz auftauchte, lief in den Kinos ein Thriller mit Sandra Bullock in der Hauptrolle. The Net (Irwin Winkler, 1995) zeigt eine Computerspezialistin, die ihre Beziehungen und geschäftlichen Kontakte praktisch komplett übers Internet abwickelt. Dies führt im Lauf des Films dazu, dass sie die Kontrolle über ihren Besitz, ihr Leben, ihre Beziehungen und ihre Identität verliert: Ihre Kreditkarten sind ungültig, ihre Sozialversicherungsnummer einer vorbestraften Frau zugeteilt, ihr Haus wird verkauft. Das Internet wird von der effizienten Technologie zur lebensbedrohlichen Waffe, die sich gegen die Benutzerin selbst wendet.
Diese düsteren Hollywood-Vision beschreiben keine Realität – aber sie zeigen, wie stark die Ängste sind, die mit der Gestaltung einer Online-Identität und der Pflege eines digitalen Beziehungsnetzes zusammenhängen. Wenn es sich letztlich nur um Daten handelt, die abbilden, wer ein Mensch ist und mit wem er in Kontakt steht, dann scheint es naheliegend, dass diese Daten missbraucht werden.

Michael Seemann, ein deutscher Kulturwissenschaftler, der in seinen Arbeiten die gesellschaftlichen Veränderungen durch digitale Technologie nachzeichnet, fasst diese Zusammenhänge wie folgt zusammen:
Die These vom Kontrollverlust besagt, dass wir zunehmend die Kontrolle über Daten und Inhalte im Internet verlieren. Betroffen ist jede Form der Informationskontrolle: Staatsgeheimnisse, Datenschutz, Urheberrecht, Public Relations, sowie die Komplexitätsreduktion durch Institutionen.
Die Vorstellung von »informationeller Selbstbestimmung«, die viele Menschen haben und die auch rechtlich dokumentiert ist, ist angesichts der Möglichkeiten der Datensammlung, der Datenspeicherung und insbesondere der Datenverknüpfung nicht mehr länger haltbar. »Ein Kontrollverlust entsteht, wenn die Komplexität der Interaktion von Informationen die Vorstellungsfähigkeiten eines Subjektes übersteigt«, schreibt Seemann (pdf, S. 74). Er gibt dafür zwei Gründe an: Erstens bilden mobile und stationäre Aufzeichnungsgeräte die Welt heute digital ab; es gibt keine Handlung, die nicht zu einem Datensatz führen könnte. Zweitens ist es im Internet praktisch kostenlos möglich, Informationen weiterzugeben. Die Konstruktion des Internets ist dem Schutz von Daten entgegengesetzt, weil sie die Zirkulation von Daten erfordert.
Regierungen versuchen dem Kontrollverlust durch immer restriktivere Gesetzgebung in Bezug auf Internetkommunikation beizukommen. Nach dem Vorbild von China gibt es mittlerweile eine Reihe von Ländern, die Inhalte im Internet blocken und den freien Austausch von Informationen behindern. Die Organisation Reporters Without Borders zählt neben China elf weitere Ländern zu den »Feinden des Internets«, 14 weitere Ländern stehen unter Beobachtung, darunter auch Frankreich, Australien und die Türkei (Reporters Without Borders, S. 2) Bezeichnend ist, dass es in diesen Ländern für Expertinnen und Experten immer noch möglich ist, die Sperren zu umgehen und Informationen zu verbreiten, die Bemühungen zur Kontrolle also auch scheitern, wenn sie von Regierungen mit enormen Aufwand unternommen werden. Das heißt nicht, dass die Zensurbestrebungen nicht verheerende Folgen für die Grundrechte der Menschen in diesen Ländern hätten; aber es zeigt, dass der Kontrollverlust in der Internetkommunikation eine Tatsache ist, die nicht rückgängig zu machen ist.

Diese Einsicht führt Seemann dazu, den Kontrollverlust zu akzeptieren und mit einem ethischen Konzept der Filtersouveränität zu koppeln:
Die Freiheit des Anderen, zu lesen oder nicht zu lesen, was er will, ist die Freiheit des Senders, zu sein, wie er will. «Filtersouveränität», so habe ich diese neue Informationsethik genannt, ist eine radikale Umkehr in unserem Verhältnis zu Daten.
Praktisch bedeutet das, dass Informationen so mitgeteilt werden sollen, dass andere in der Lage sind, Filter einzusetzen. Zu denken sind Beispielsweise an Werbefilter: Moderne Browser ermöglichen die Installation von Zusatzprogrammen, die Werbung im Internet komplett ausblenden (z.B. AdBlock). Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und Instragram zwingen User immer stärker dazu, sich auch Werbung anzusehen, indem sie direkt in die Funktionalität der Werkzeuge eingebunden wird. Wer die Dienste nutzen will, muss sich Werbung ansehen. Filtersouveränität wird verhindert.
Würde man Seemanns Überlegungen auf die Schule beziehen, so müsste man Schülerinnen und Schülern basierend auf der Einsicht, dass Lehrpersonen nicht kontrollieren können, was mit ihren Inhalten und Inputs passiert, die Freiheit gewähren, aus dem Informationsausgebot auszuwählen.
Filter allgemein verstanden ermöglichen die Suche nach erwünschten und das Ausblenden von unerwünschten Inhalten. Sie sind deshalb wichtig, weil die Speicherkapazitäten digitaler Medien heute die menschliche Fähigkeit, Daten zu verarbeiten, bei weitem übersteigern. Das zeigt das Potential dieser Entwicklung: Von Lehrerseite her kann jede Redundanz vermieden werden. Lehrvorträge müssten einmal gehalten werden und wären dann immer abrufbar, auffindbar. Dadurch könnten viel mehr interessante Referate zu verschiedenen Themen entstehen, eine Beschränkung auf ausgewählte Themen um Schülerinnen und Schüler nicht zu überfordern, wäre nicht nötig – da sie ja ihre eigenen Filter einsetzen und mit denen Überforderung verhindern. Die Fähigkeit, Filter einzusetzen, stellt eine wesentliche Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien dar.