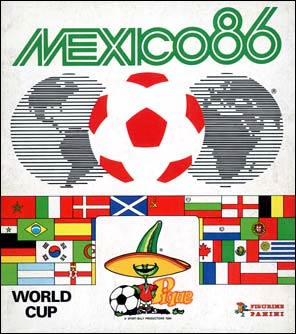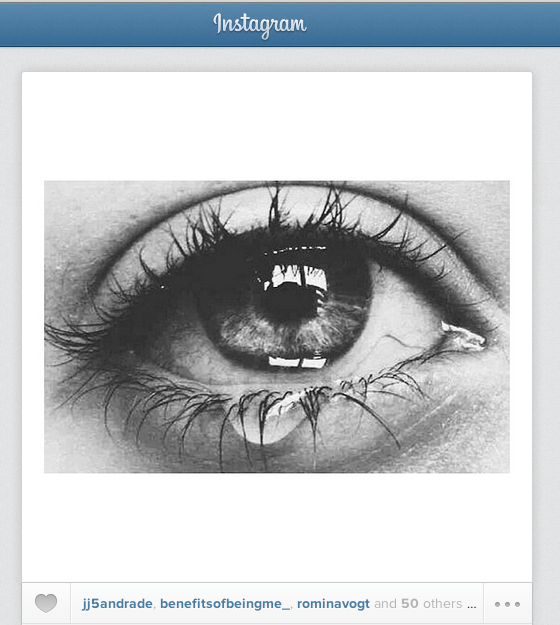Heute bin ich an der SGKM-Jahrestagung 2014 auf einem Panel engagiert, bei dem es um die Frage geht, wie »Digital Natives« mit Hard News umgehen. Hier meine Notizen zu meinem Inputreferat. Allfällige Erkenntnisse aus der Diskussion werde ich später anfügen.
* * *
Ich werde im Folgenden zwei Kernthesen vertreten:
- Es gibt keine »Digital Natives«, weil die Kategorie ein Behelfswort ist, mit dem Erwachsene versuchen, die Verunsicherung durch die Digitalisierung zu bewältigen.
- News werden nicht »softer«, sondern aus einem Kanon gelöst: Das Selbstverständnis dessen, was jemand wissen muss, um als informiert zu gelten, hat sich aufgelöst. Das betrifft Jugendliche besonders.
Diese Thesen möchte ich an einem Beispiel verdeutlichen: Mit rund 17-jährigen Schülerinnen und Schüler der Fachmittelschule spreche ich immer am Freitagmorgen um acht über aktuelle Themen, die in den Medien Resonanz finden: Ohrfeigen, politische Entwicklungen in der Ukraine, der Fall Carlos.
Ich halte die Schülerinnen und Schüler an, drei Fragen zu beantworten:
- Was wissen Sie darüber?
- Woher wissen Sie es?
- Was denken Sie selbst darüber?
Die Ergebnisse sind immer erstaunlich differenziert: Gemeinsam schafft es einer Klasse, ein präzise Bild aktueller Entwicklungen zu zeichnen und sich darüber eine Meinung zu bilden. Die Informationsquellen, welche die Schülerinnen und Schüler dabei verwenden, sind enorm unterschiedlich: Sehr verbreitet ist die 20Minuten-App und Links, die auf Facebook verschickt werden. Ebenfalls eine große Rolle spielen die Medien, die im Haushalt der Eltern genutzt werden: Abonnierte Tageszeitungen, die Tagesschau, Radiosendungen.
Jugendliche interessieren sich sehr für solche Lektionen und Gespräche über Hard News und die Funktionsweise von Medien. Sie übernehmen viele Urteile von ihren Eltern und Lehrpersonen: Wikipedia misstrauen sie stärker, als das sinnvoll ist, traditionellen Medien vertrauen sie fast automatisch. Entscheidend sind für sie aber Urteile von Bezugspersonen, die sie für kompetent halten.
Ihre Frustration resultiert meist daraus, dass es anstrengend und aufwändig ist, sich zu informieren. Spreche ich mit Jugendlichen über Nachrichtensendungen, beklagen sie sich darüber, dass ihnen die Zeit fehlt, sich seriös zu informieren. Das führt teilweise zu einer Frustrationsspirale: Je stärker sie sich bemühen, auf dem Laufenden zu bleiben, desto stärker wird das Gefühl, zu wenig zu einem Thema zu wissen.
Jugendliche nutzen Social Media für die Kommunikation mit Peers. Wer den sozialen Anschluss nicht verpassen will, muss WhatsApp oder Instagram nutzen. Dabei wandeln sich viele Informationsprozesse vom Push- zum Pull-Prinzip: Wer sich darüber informieren will, was Bekannte tun, kann das aus den Social-Media-Streams rauslesen, und muss nicht warten, bis das bei einem Treffen erzählt wird. Ähnlich verhalten sich Jugendliche Nachrichten gegenüber: Interessieren sie sich für einen Zusammenhang, rufen sie diesbezügliche Informationen ab, statt sich regelmäßig damit über feste Kanäle berieseln zu lassen.
Das heißt aber nicht, dass sie dabei automatisch bestimmte Kompetenzen erwerben oder News ausschließlich auf Social-Media-Kanälen erhalten wollten. Jugendliche wissen sehr genau, wie Manipulation funktioniert und dass nicht alles stimmt, was im Internet steht. Sowohl die Vorstellungen von automatischem Kompetenzerwerb wie auch die implizierte Naivität im Umgang mit Medien halte ich für Vorurteile, die Erwachsene brauchen, weil sie von der Informationsflut überfordert sind.
Kürzlich hat mich auf meinem Blog eine Anfrage von einem Arzt aus Deutschland erreicht, der mir folgende Frage gestellt hat:
Wie informiert man sich “richtig”?
Zudem habe ich immer wieder den Eindruck, nicht ausreichend informiert zu sein, obwohl ein großes Angebot am Kiosk oder auch an den oben genannten Orten zur Verfügung steht. Es ist schon seltsam, “früher” hatte man als Leser klassischerweise ein bis zwei Zeitungen, schaute Tagesschau um Punkt 20 Uhr und war bestens informiert und konnte ruhig schlafen. Aber zu dieser Nutzungsweise kann ich auch nicht mehr zurückkehren, ich denke ich verpasse etwas.
Haben Sie für dieses dieses Problemfeld einen Tipp für mich?
Das Gefühl, ständig etwas zu verpassen, ist unter erwachsenen Medienkonsumentinnen und –konsumenten verbreitet. Wer sich die aktuellen Serien im Schweizer Fernsehen anschaut, wird von den Downloadern belächelt, wer am Morgen intensiv Zeitung liest, muss damit rechnen, dass seit dem Druck der Zeitung entscheidende Entwicklungen vonstatten gegangen sind.
Die Hoffnung, dass Jugendliche mit dieser Informationsflut kompetent umgehen können, dafür Filter und Relevanzkriterien entwickeln, einfach deshalb, weil sie jünger sind, ist so naheliegend wie falsch. Wie Erwachsene brauchen Jugendliche Anleitung dabei, wie man Unwichtiges ausblendet und den Informationsgehalt von Nachrichten beurteilt. Sie brauchen Einstiegshilfen, um Journalismus auch zu verstehen, wenn sie nicht regelmäßig Dossiers zur Kenntnis genommen haben.