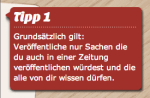Gestern hat Thinh-Lay Bosshart die Ergebnisse eines Selbstversuchs mit dem Chat-Support von Pro Juventute veröffentlicht, der heute auf Facebook zu einigen Diskussionen Anlass gegeben hat (FB-Link, Gruppe »Medienpädagogik«). Als Reaktion darauf möchte ich einige Bemerkungen zur Kampagne von Pro Juventute anfügen, die meinen Kommentar zur Sexting-Kampagne ergänzen.
- Die Aufklärungsarbeit von Pro Juventute ist wichtig und richtig. In Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten wird die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit mit der kostspieligen Kampagne auf ein medienpädagogisches Thema gelegt, das tatsächlich Aufmerksamkeit verdient.
- Die fachlichen Informationen, die Pro Juventute z.B. in den Merkblättern zur Verfügung stellt, sind hochwertig und empfehlenswert. Sie sind kompakt, praxisnah und korrekt.
- Sexting ist – wie auch Cybermobbing – keines der großen Themen von Pro Juventute. Sexting betrifft eines von 450 Gesprächen, die Pro Juventute mit Jugendlichen täglich führt.
- Der Vorwurf, die Kampagne würde dafür benutzt, Spendengelder einzutreiben, der beispielsweise bei der Cybermobbing-Kampagne in der NZZ erhoben wurde, mag einen wahren Kern haben, verkennt aber, wie sich Organisationen wie Pro Juventute finanzieren müssen. Marketing ist wichtig und es ist keineswegs verwerflich, das Marketing mit einer Aufklärungskampagne zu verbinden.
- Dennoch bleibt ein schaler Nachgeschmack, dass ein Bild der Jugend gezeichnet wird, das der Realität nicht ganz gerecht wird. Jugendliche betreiben Sexting, aber die Praxis ist nicht Alltag und betrifft nicht alle Jugendlichen. Ein Schulleiter einer Zürcher Oberstufe hat kürzlich von drei Fällen im letzten halben Jahr gesprochen, mit denen er sich beschäftigen musste. Sicher kein vernachlässigbares Problem, aber beispielsweise nicht auf eine Stufe mit familiären Problemen zu stellen.
- Die Präsenz in den sozialen Netzwerken könnte professioneller ausfallen. Die Beratung im Chat sollte zumindest an kompetente Fachleute weiterverweisen, wenn sie selbst keine kompetente Auskunft geben kann.
- Das betrifft auch den Cyber-Risiko-Check. Er ist auf Facebook beschränkt – eine Plattform, die gefährdete Jugendliche (also die jüngsten) neben WhatsApp und Instagram immer weniger nutzen.
Dazu kommuniziert er medienpädagogisch paradox: Er verlangt Zugriff zum eigenen Facebook-Profil und möchte sogar im eigenen Namen publizieren können – will aber gleichzeitig vermitteln, dass der Zugriff zum Profil möglichst vorsichtig gehandhabt werden sollte. Die Kriterien, nach denen die Empfehlungen erfolgen, sind zudem wenig transparent und die Tipps an der Oberfläche. Echte Präventionsarbeit muss sich stärker auf Kontexte beziehen und funktioniert auf einer so allgemeinen Ebene nicht.
Fazit: Während die Kampagne sinnvoll ist, dürfte sie in der konkreten Ausgestaltung sorgfältiger sein. Lieber etwas genauere Information, dafür weniger Möglichkeiten, als allgemeine Hinweise, die im konkreten Fall wenig nützen.