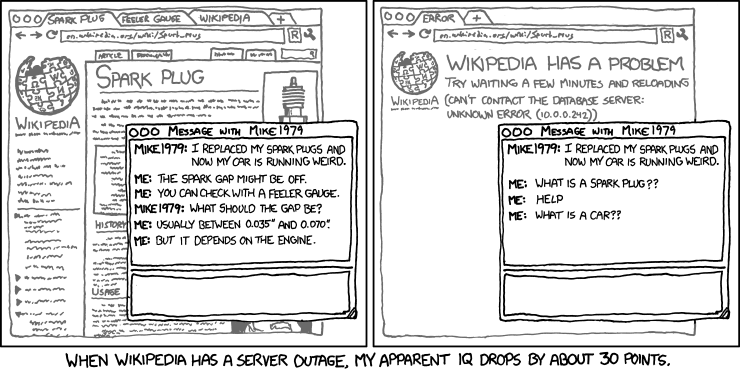Bei Medium hat Zeynep Tufecki einen klugen Essay über die Ursachen für die gescheiterte Budgetdebatte in den USA geschrieben – wer sich dafür nicht interessiert, sollte den ersten Abschnitt überspringen.
Die aktuelle Budgetkrise in den USA stellt deshalb eine Kuriosität dar, weil über 70 Prozent der Amerikanerinnen und Amerikaner dafür sind, dass der »Government Shutdown« beendet wird, die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker aus der Republikanischen Partei aber keine Angst haben müssen, nicht wiedergewählt zu werden, obwohl sie sich der öffentlichen Meinung so klar widersetzen. Tufecki erklärt das damit, dass diese Sitze aus Wahlkreisen stammen, die bewusst so gestaltet worden sind, dass sich Republikaner mit Sicherheit durchsetzen – obwohl die Demokraten 1.4% mehr Stimmen erhalten haben als die Republikaner, haben letztere 17 Sitze im Kongress mehr, weil sie in der Lage sind, die Wahlkreise an vielen Stellen selbst festzulegen. Daher ist es den Tea-Party-Republikanern oft völlig egal, was die öffentliche Meinung im ganzen Land ist, weil sie sich auf einen Wahlkreis konzentrieren, der von konservativen Weißen bestimmt wird und in dem sich demokratische Kandidatinnen und Kandidaten unter keinen Umständen durchsetzen könnten.

Tufeckis Einleitung hat damit direkt nichts zu tun, sondern formuliert in wenigen Sätzen eine wichtige Perspektive auf die Kommunikation im Internet. Daher zuerst das leicht gekürzte Original, dann meine Übersetzung:
Are you looking to blame the Internet for something? Forget what you’ve read in most popular media. It’s not making people more angry, narcissistic or lonely.
Not a week goes by in which a headline in a major new outlet doesn’t claim that the Internet turns us into something or other. The internet has been blamed for everything from stupidity to narcissism to loneliness to anger. When you dig down into such stories, you often find that the popular writers have either misunderstood the study—which often merely shows that the Internet reflects offline realities –or are cherry picking small, outlier studies while ignoring the preponderance of the research. (Yes, people who score high on offline narcissism scales behave in more narcissistic ways online. Yes, anger spreads more quickly online compared to other emotions. But guess what? Well-established research shows anger also spreads more quickly offline.) Overall, there is scant evidence, or reason, that the Internet alters fundamentals of human psychology.
The internet doesn’t change the players. It does, however, change the game. Sometimes, drastically. In other words, if you want to understand what the Internet changes, look first to game theory, not psychology. We don’t have a different kind of human as a result of the Internet. We do, however, have different kinds of structures which change the games humans play in their social, personal and political lives.Möchtest du dem Internet die Schuld für etwas zuschreiben? Dann vergiss, was du in vielen Medien gelesen hast. Das Internet macht Menschen nicht wütiger, narzisstischer oder einsamer.
Es vergeht keine Woche, ohne dass eine wichtige Zeitung oder Zeitschrift in einer großen Schlagzeile behauptet, das Internet würde uns zu diesem oder jenem machen. Von Dummheit über Narzissmus, von Einsamkeit oder Wut – dem Internet wurde für fast alles schon die Schuld gegeben. Wühlt man sich durch solche Geschichten, findet man meist heraus, dass die Autorinnen und Autoren entweder die Studien falsch verstanden hatten – weil die meist zeigen, dass das Internet zum Ausdruck bringt, was sich in der Offline-Realität abspielt – oder kleine, unbedeutende Studien rauspickt, die dem Rest der Untersuchungen widersprechen. (Ja, Menschen die offline narzisstisch sind, verhalten sich online narzisstischer. Ja, Wut verbreitet sich online schneller als andere Gefühle. Aber rate mal? Auch offline verbreitet sich Wut schneller.) Es gibt allgemein kaum Belege oder Gründe dafür, dass das Internet die menschliche Psychologie verändere.
Das Internet verändert mit anderen Worten nicht die Spieler, sondern das Spiel. Manchmal auf drastische Art und Weise. Wer verstehen will, was das Internet ändern, sollte sich mit Spieltheorie beschäftigen, nicht mit Psychologie. Das Internet schafft keine neuen Menschen. Aber es kreiert neue Strukturen und die verändern die Spiele, die Menschen in ihrem sozialen, persönlichen und politischen Leben spielen.
Man kann das wohl am besten am Beispiel der Aufmerksamkeit zeigen. Wer sich mit fremden Menschen über Politik streiten will, kann das offline wie online tun. Aber das Spiel ist online ein ganz anderes. Der Preis dafür (oder der Aufwand) ist kleiner, die resultierende Aufmerksamkeit anders, unter Umständen größer, zumindest gibt es mehr Zuschauer. Die wiederum sind ein sehr selektives Publikum: Würde ich mich in einer Kneipe mit Fremden auf politische Diskussionen einlassen, dann wären wohl einige zufällige Gäste anwesend, von denen sich wenige überhaupt einen Reim auf die allenfalls lautstarke Diskussion machen können. Im Internet sind aber meine Gäste da – sie sehen auf meiner Pinwand oder in ihrer Timeline, mit wem ich mich worüber streite. Weil der Preis für die Handlung kleiner wird und die Belohnung größer, kann es gut sein, dass Menschen online häufiger engagierte politische Diskussionen führen. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass das für sie an Bedeutung gewonnen hätte, weil es das Internet gibt.