Gestern ist im Sonntag meine Meinung zum Frontalunterricht erschienen, die ich hier schon als Blogpost entworfen habe. Der Text kann auch digital gelesen werden.
Ich freue mich über Kommentare.

Philippe Wampfler
Gestern ist im Sonntag meine Meinung zum Frontalunterricht erschienen, die ich hier schon als Blogpost entworfen habe. Der Text kann auch digital gelesen werden.
Ich freue mich über Kommentare.

Die Zeit berichtet über ein Projekt in Estland, das von der Tiger Leap Foundation initiiert worden ist. Momentan läuft ein Pilotprojekt. Ziel ist, dass alle Schülerinnen und Schüler in Estland in der Grundschule lernen zu programmieren.
Doch können Grundschüler wirklich schon programmieren lernen? Ja, sogar schon in der ersten Klasse, glaubt Ave Lauringson. Der Programmierunterricht in Estland soll gleich nach der Einschulung losgehen. Möglich machen das spezielle Programmierumgebungen für Kinder. Dabei wird nicht wie in einer klassischen Programmiersprache Zeile für Zeile ein komplizierter Code aus Text und Zahlen aufgeschrieben, sondern die Kinder ziehen einfache Befehle als farbliche Blöcke in ein Feld. Wenn man alles richtig zusammengebaut hat, läuft auf dem Bildschirm zum Beispiel eine Katze einer Maus hinterher. So lernen Kinder, wie Programme aufgebaut sind und dass der Computer kein magisches Gerät mit einem mysteriösen Eigenleben ist, sondern eine Maschine, die man dressieren kann.

Der Artikel betont vor allem die Funktion der Informatik für eine spätere Berufsausbildung im technischen oder im IT-Bereich. Die Formulierung der Tiger Leap Foundation ist etwas offener:
The aim of the Tiger Leap Foundation is to foster pupils’ interest towards science and help them acquire the skills for using modern technology wisely in the course of their studies.
Beat Doebeli geht in einer Zusammenfassung eines Vortrags von Simon Peyton Jones noch einen entscheidenden Schritt weiter:
In diese Richtung zielt auch, dass Simon Peyton Jones mehrfach betont hat, bei seinen Bemühungen gehe es ihm nicht um das eine Prozent, dass nachher Informatik studiere, sondern um die 99%, die keinen Informatikberuf ergreifen würden. Es gehe um Allgemeinbildung; darum, dass in einer Informationsgeselllschaft, alle und eben nicht nur die Informatiker eine gewisse Ahnung über Informatik haben müssten.
Dem kann ich zustimmen. Die Überlegungen zum Status des Programmierens und der Informatik in der Schule, die ich hier bereits festgehalten habe, sind immer allgemeinbildend zu verstehen. Bildungscurricula auf spezifische Berufsbilder auszurichten, ist in einer Gesellschaft, in der berufliche Anforderungen sehr dynamisch sind, äußerst gefährlich.
Hirnforschung wird heute als »Universalschlüssel« zum Verständnis des Menschen und seiner Lebensweise betrachtet. Oft wird dabei übersehen, dass die bildgebenden Verfahren viele Zusammenhänge vereinfachen, auf willkürlichen Entscheidungen beruhen und nur innerhalb eines Modells des Menschen eine Aussagekraft haben. Es ist zudem äußerst schwierig, einen so komplexen kommunikativen Wandel, wie er mit Social Media verbunden ist, isoliert neurologisch zu untersuchen.
Wird also darüber gesprochen, was neue Medien mit unseren Hirnen oder den Hirnen von Kindern und Jugendlichen anstellen, ist Vorsicht geboten. Das gilt für die Voraussage, wir würden lernen, problemlos mehrere Aufgaben gleichzeitig zu bearbeiten und können Reize viel schneller verarbeiten, wie auch für die Befürchtung, wesentliche Denkfähigkeiten durch falschen Mediengebrauch bedroht seien. Ganz bösartig kommentierte Martin Robbins eine skeptische Studie der Neurowissenschaftlerin Susan Greenfield, indem er ihren Erkenntniswert zusammenfasste:
Greenfield [behauptet], dass eine unbestimmte Art von Umgang mit einem unbestimmten Teil moderner Technologie eine unbestimmte Anzahl menschlicher Hirne auf eine unbestimmte Art beeinflussen kann, so dass unbestimmte Effekte eintreten. (übers. Ph.W.)
Dennoch kann man folgende vorsichtigen Aussagen machen:
Im Sinne einer Bilanz kann man davon ausgehen, dass digitale Medien einer gesunden Entwicklung nicht entgegenstehen, wenn sie wichtige menschliche Aktivitäten nicht ablösen, sondern ergänzen. Das physische Begreifen der Welt, Sport, Musik oder Theater sind in der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen nicht zu ersetzen. Aber es ist möglich, zusätzlich dosiert am Computer zu spielen, das Smartphone in einem sinnvollen Kontext als Lerninstrument zu nutzen und mit Freundinnen und Freunden auf Facebook zu chatten.
Die Hirnforschung kann der Pädagogik nützliche Hinweise geben. Zwar versuchen Menschen schon seit Jahrtausenden die Erziehung der Kinder zu optimieren. Da gibt es bereits einen großen Schatz an empirischem Wissen, so dass man von der Hirnforschung keine revolutionären Veränderung mehr erwarten kann. […] Die Hirnforschung gibt uns viele Hinweise, die bessere, eindringlichere und damit letztlich auch erfolgreichere Medienangebote ermöglichen. Denken Sie etwa an den aktuellen Trend, Fernseh- und Computermonitore zu produzieren, die einen Tiefeneindruck ermöglichen und den Betrachter gewissermaßen in die Mitte des Geschehens versetzen.
Der Frontalunterricht ist in aller Munde. Seit die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Mitte Dezember den Frontalunterricht gelobt hat – »Frontalunterricht macht klug« / »Klassischer Frontalunterricht produziert gute Resultate« – trifft man überall auf Befürworterinnen und Befürworter der Methode: Von den Lehrenden, die insgeheim schon immer gewusst haben, wie gut die Methode ist (nichts anderes wird übrigens in der didaktischen Ausbildung gelehrt: guter Frontalunterricht ist eine effiziente Methode), bis zu den ehemaligen Schülerinnen und Schülern, die guten Lehrerinnen und Lehreren einfach gern zugehört haben, stimmen alle ins wissenschaftlich belegte Lob ein.
Vergessen geht dabei, wie limitiert die Vorstellungen von Schule, Unterricht, Funktion der Lehrperson, Leistung und Erfolg sind, die mit diesem Lob verbunden sind. Man geht davon aus, alle Schülerinnen und Schüler müssten dasselbe lernen, müssten es von der Lehrperson lernen und würden dann Leistung erbringen, wenn ihre Resultate in standardisierten Vergleichstesten besser als die anderer sind.
Dabei gibt man den eigenen, verinnerlichten Maßstab aus der Hand. Die Schule sozialisiert junge Menschen so, dass sie selber nicht entscheiden müssen oder dürfen, was sie lernen wollen, wie sie lernen wollen und wie gut sie etwas gelernt haben. Nicht einmal ihre Lehrerin oder ihr Lehrer darf das entscheiden, sondern es wird von außen (von wem eigentlich genau) vorgegeben. »Ich habe so keine Lust auf Mathematik«, ist eine Äußerung, die man in vielen Klassen an vielen Schulen regelmäßig hört. Nützt nichts: Mathematik steht auf dem Stundenplan, binomische Formeln müssen gelernt werden. Warum? Lehrplan, Klausuren, Arbeitswelt…
Das zentrale Argument: Es kann nicht sein, dass 25 Menschen gleichzeitig dasselbe hören müssen, um erfolgreich lernen zu können. Natürlich sollen sie inspirierenden Lehrenden zuhören: Zu dem Zeitpunkt, an dem sie dafür offen sind, wo sie davon profitieren. Und wann dieser Zeitpunkt ist, müssen sie selber entscheiden lernen. Kinder und Jugendliche wollen lernen (und wenn sie das einmal nicht wollen, dann haben sie vielleicht sogar das Recht dazu). Sie werden – dank Social Media – immer stärker informell, privat lernen, unterstützt durch technische Geräte und Expertinnen und Experten, die ihnen weltweit zeigen, wie man einen Song auf der Gitarre spielt, wie man chinesische Wörter ausspricht oder wie man mit binomischen Formeln umgeht.
Dieses Lernen ist dann nicht vergleichbar und nicht standardisierbar, weil Lernen per se nicht vergleichbar und standardisierbar ist.
Der Frontalunterricht erlebt ein Revival, weil viele pädagogische und didaktische Grundeinsichten vergessen gehen. Er ist in der heutigen Bildungslandschaft relativ besser als halbbatzig umgesetzte Alternativen. Aber er nicht per se besser als offene Lernumgebungen, eigenständig initiierte Lernprozesse und echte Kollaboration unter an gleichen Themen interessierten Peers.
Guter Frontalunterricht – so mein Fazit – ist der, den Schülerinnen und Schüler selber wählen und in dem sie jederzeit aufstehen und rausgehen können. Erzwungener Frontalunterricht ist keine gute Lernform.
* * *
Zusatz – Max Woodtli schreibt:
Solange Schule nach wie vor als Wissensanhäufungsinstitution gesehen wird, wo Wissenskonserven von einer Lehrperson im Gleichtakt den SchülerInnen “eingetrichtert” werden müssen, wie auf dem Bild (aus dem Jahre 1929) des Artikels dargestellt, mag Frontalunterricht sicher eine effiziente Methode sein. Das hat aber leider nichts mit Lernen und schon gar nichts mit den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts zu tun.
Im Jahrbuch der Kantonsschule Wettingen 2011/2012 (ich unterrichte dort) sind zwei Texte von mir erschienen.
Der erste befasst sich mit den Herausforderungen der digitalen Kommunikationskultur für die Schule; der zweite mit einer Weiterbildungsveranstaltung für Lehrpersonen zum Thema Social Media. Die pdfs sind leider Scans von mäßiger Qualität, sobald ich das Original vorliegen habe, werde ich sie ersetzen.
Social Media und die Bildungsorganisation sind geprägt von Standardisierungsbemühungen und hierarchischen Strukturen, obwohl sowohl die Ideale der dialogischen Kommunikation in Netzwerken und die des nachhaltigen Lernens Standards und Hierarchien einer fundamentalen Kritik unterziehen.
Der Aufbau von Netzwerken und die Organisation von Lernprozessen gehen von Subjekten aus. Sie erfolgen bottom-up: Entscheidend sind Motivation, Interessen und persönlicher Nutzen. Wesentliche Aspekte sind nicht messbar, nicht vergleichbar, nicht durch Standards abbildbar und nicht top-down festlegbar.
Vorgaben verhindern Abweichungen. Konzeptionell geht es dabei meist um unerwünschte Abweichungen: Auf standardisierten sozialen Netzwerken gibt es keine Überraschungen, keine unangenehme Erfahrungen für die User. In einer standardisierten Bildungslandschaft lernen alle Schülerinnen und Schüler mit ähnlichen Methoden ähnliche Inhalte und werden ähnlich bewertet.
In der Realität werden aber vor allem positive Abweichungen verhindert: Innovative Projekte sind innerhalb der engen Grenzen des auf Social Media Erlaubten nicht mehr möglich. Ebenso können Lehrpersonen mit ganz spezifischen Stärken und Vorlieben diese in einer standardisierten Bildungslandschaft nicht entsprechend gewichten, sie können nicht auf Wünsche oder Bedürfnisse von Lerngruppen eingehen, weil festgelegt ist, was wie unterrichtet werden muss.
Die große Herausforderung für Social Media ist es, dezentrale Netzwerke zu schaffen (vgl. Lovink). Nur so können sie ihr gesellschaftliches und politisches Potential entfalten, ohne einen kommerziellen Nutzen innerhalb eines engen Gerüstes von Normen erbringen zu müssen. Entsprechende Projekte scheinen alle zwar viele Bedürfnisse von Benutzerinnen und Benutzern aufzunehmen, sich aber nicht durchsetzen zu können: Zu stark sind die großen Player wie Facebook, Google oder Twitter, welche durch die Speicherung von Daten viele User in ein Abhängigkeitsverhältnis treten lassen.
Auch hier gibt es eine Parallele zur Schule: Innovative Projekte werden zwar immer wieder formuliert, sie scheitern aber auch an der Macht der staatlichen und standardisierten Schule, deren Diplome eine politisch und gesellschaftlich klar bestimmten Wert haben. »Bildung für alle« im Sinne von Lindner ist nur möglich, wenn dezentrale Lernnetzwerke entstehen können.

Man könnte abschließend davon sprechen, dass sowohl Social Media wie die Bildungsstrukturen gehackt werden müssen: In ihrem Selbstverständnis lösen Hacker auf kreative und ästhetische ansprechende Art und Weise Probleme. Sie tun dies als intellektuelle Herausforderung, nicht um einem von außen vorgegebenen Zweck zu genügen, und umgehen dabei Beschränkungen und Hindernisse, ohne auf Erwartungen Rücksicht zu nehmen. Dieses Ideal kann sowohl auf die Internetkommunikation wie auch auf die Bildung bezogen werden: Wenn sie funktionieren, dann bringen sie Menschen dazu, kreativ Probleme zu lösen, weil sie daran Spaß haben. Es wäre zu wünschen, dass dies gelingen kann.
Dieses Merkblatt sollte vor einer intensiven Nutzung von Social Media im Unterricht abgegeben werden. Die Schülerinnen und Schüler werden gesiezt. Das Merkblatt enthält wichtige Punkte von einem ähnlichen Merkblatt von Mary Chayko (private Kopie, nicht online). Ich freue mich über Hinweise zur Verbesserung der Merkblatts.
Eine aktuelle Version kann als .pdf- und .doc-File hier geladen werden. Sie unterscheidet sich leicht vom Blogpost.
Soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, Foren, Chats und Blogs werden heute für die Kommunikation mit Freunden und Familie auf verschiedene Arten genutzt. Wie im direkten Kontakt mit anderen Menschen repräsentieren Sie auf sozialen Netzwerken sich selbst, Ihre Familie und Ihre Schule. Verhalten Sie sich deshalb anständig und seien Sie ehrlich. Dabei helfen Ihnen die folgenden Hinweise.
Wenn Sie im Unterricht Aufgaben erhalten, die sich mit Social Media erledigen lassen, dürfen und sollen Sie das auch tun. Es stehen Ihnen aber immer auch alternative Arbeitsmethoden zur Verfügung, niemand wird zur Benutzung von sozialen Netzwerken gezwungen.
Ich habe schon einmal darüber berichtet, dass es im Kanton Basel-Stadt (Schweiz) die Aufgabe der Polizei ist, »Kinder und Jugendliche bei einem selbstständigen, kritischen und verantwortungsbewussten Umgang mit den neuen Medien zu unterstützen«.
Dafür hat die Kantonspolizei – genauer: die Präventionspolizei – sogar ein eigenes Facebook-Profil erstellt:
Dort publizierte sie auch eine Umfrage zum Littering-Verhalten der Jugendlichen:

Wie 20Minuten und die bz berichten, kam es dabei zu einem peinlichen Problem: Die Antworten der Teilnehmenden erschienen auf deren Facebook-Chronik, waren also für all ihre Kontakte oder sogar für die Öffentlichkeit einsehbar. Damit wurden, so die Zeitungstitel, die Jugendlichen wegen Littering »geoutet« – ein in der Präventionsarbeit denkbar schlechtes Vorgehen. In 20Minuten wird der Sprecher der Kantonspolizei zitiert:
Laut Polizeisprecher Klaus Mannhart handelt es sich um ein Versehen: «Dass die Antworten auch in der Chronik der Teilnehmer erscheinen, wurde leider übersehen.» Der Präventions- und Jugendpolizei würden bei der Bewirtschaftung ihrer Facebookseite gewisse Freiheiten gewährt. Jedoch zeige das Beispiel, dass der Umgang mit Social Media komplexer sei als angenommen. Mannhart: «Wir werden die Situation überprüfen und eventuelle Massnahmen evaluieren.»
Man muss die Frage stellen, ob Präventionsarbeit und Vermittlung von Medienkompetenz von einer Stelle geleistet werden soll, welche die Komplexität sozialer Netzwerke unterschätzt. Generell kann man fragen, ob die Polizei in der Lage ist, Jugendliche in der Mediennutzung zu begleiten. Im Kontakt mit der Polizei ist der Gedanke an das Überschreiten von Gesetzen und den Schutz vor kriminellem Verhalten ständig präsent.
Meine Meinung: Den Umgang mit neuen Medien müssen Kinder und Jugendliche von ihren Eltern und ihren Lehrpersonen lernen, nicht von der Polizei.
Wie 42floors berichtet, gibt es Datenbanken, die Webseiten anbieten, Menschen zu identifizieren, die sich ihre Seite ansehen. Das heißt konkret:

42floors erwähnt ein analoges Beispiel für diese Möglichkeiten:
You drive to Home Depot and walk in. Closed-circuit cameras match your face against a database of every shopper that has used a credit card at Walmart or Target and identifies you by name, address, and phone. If you happen to walk out the front door without buying anything your phone buzzes with a text message from Home Depot offering you a 10% discount good for the next hour.
[Übersetzung phw:] Du fährst zum Baumarkt und gehts rein. Überwachungskameras erkennen dein Gesicht, vergleichen es mit einer Datenbank aller Menschen, die schon jemals eine Kreditkarte in einem Supermarkt verwendet hat und identifizieren dich mit Name, Adresse und Telefonnummer. Sobald du rausgehst, ohne was gekauft zu haben, erhältst du eine SMS, die dir einen 10%-Gutschein offeriert, wenn du innerhalb der nächsten Stunde etwas kaufst.
Dieses Beispiel ist heute technisch möglich. Was im Internet passiert, passiert wohl auch in nicht primär digitalen Szenarien. Wir sind überall identifizierbar.
Niemand weiß, wie die digitale Welt in 10 Jahren aussehen wird. Während sich die westlichen Gesellschaften in den letzten 50 Jahren nur marginal verändert haben, ändern sich digitale Praktiken sehr schnell: Wir haben alle die Zeit erlebt, in der wir mit Pseudonymen im Internet aktiv waren – heute sind die meisten von uns mit unserem Namen präsent; ohne dass sich viele Menschen überlegt haben, warum das so sein könnte.
Blicke ich in die digitale Zukunft und damit auch in die Zukunft von Social Media, dann denke ich meist an Algorithmen oder Bots. Die Science Fiction war lange von Robotern geprägt, Menschen nachgebildeten Geräten, die vollautomatisch operierten. Man kann die Form und sogar die Materialität weglassen und einfach von »Handlungsvorschriften, die nach einem bestimmten Schema Zeichen umformen« sprechen – wie das Mercedes Bunz in ihrem hervorragend Buch Die stille Revolution tut. Gibt es solche Handlungsvorschriften, dann gibt es natürlich auch entsprechende Geräte, die sie ausführen können – ohne dass es Menschen dazu braucht. Im Jahre 2020 wird es zwischen 50 und 100 Milliarden Geräte mit Internetanschluss geben; die alle Gegenstände und Lebewesen verwalten, nachverfolgen und orten können, die mit einem RFID-Chip ausgestattet sind. Schon 2007 gab es einen solchen Chip, der so klein wie ein Staubkorn war. Bunz spricht in ihrem Buch davon, dass diese Erkenntnis sofort zu einem Reflex führt, dass man an die totale Überwachung denkt – natürlich nicht zu Unrecht:
Wir sehen nur, wie eine bestimmte Technik in einem historischen Moment eingesetzt wird, und vergessen darüber, dass man damit auch noch ganz andere, bessere Dinge anstellen könnte. Konzentrieren wir uns noch einmal auf den wesentlichen Aspekt des Internets der Dinge: Es erlaubt uns, Projekte, für die wir neben Menschen und Informationen auch materielle Gegenstände und Räume brauchen, wesentlich schneller, leichter und vor allem kostengünstiger zu organisieren. […] damit verlieren die großen, hierarchischen, über Mitgliedsbeiträge, Steuergelder oder die von Aktionären bereitgestellten Mittel finanzierten Institutionen des Industriezeitalters ihr Monopol auf Unternehmungen eines bestimmten Ausmaßes oder Komplexitätsgrades. (156)
Während Bunz die Revolution der Algorithmen parallel zur Industrialisierung in einem gesamtgesellschaftlichen Rahmen beschreibt, möchte ich etwas konkreter zeigen, was Algorithmen für unseren digitalen Alltag bedeuten und wie sie heute – vielfach unbemerkt – schon präsent sind. Ich tue das anhand von sechs Beispielen, die ich kommentiere.
Algorithmen werden unbemerkt unverzichtbar werden. Heute können wir die Geräte eine Weile weglegen und ohne sie leben. Bald wird uns das so wünschenswert erscheinen, wie ohne Kleider aus dem Haus zu gehen. Auch das könnten wir, es ist aber nicht nur sozial geächtet, sondern auch meist sehr unbequem.
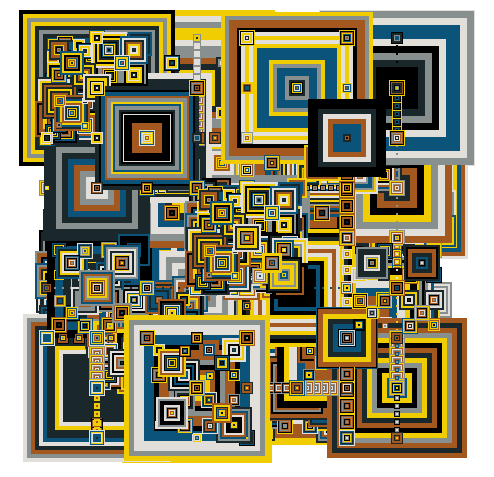
In seinem Buch Gadget hält Jaron Lanier fest, dass unsere Unfähigkeit, online zwischen Mensch und Algorithmus zu unterscheiden, eine Reduktion unseres Menschenbilds zeigt: Wir erwarten von einem Menschen nicht mehr als von einem Algorithmus. Das ist eine Sicht. Lanier behauptet, nur Menschen könnten Bedeutungen hervorbringen. Das darf stark bezweifelt werden: Bald werden uns vollautomatisch erstellte Bilder, Texte und Videos zu Tränen rühren und lachen machen, weil Algorithmen wissen, was für uns lustig ist und was berührend. Mit uns werden auch Algorithmen lachen und weinen – weil sie gelernt haben, wann Menschen das tun.
Die Digitalisierung bietet uns heute die Möglichkeit, eine andere Zukunft zu gestalten. Und aus ihr wird, was wir aus ihr machen. (160)
So der optimistische Schluss von Bunz‘ Buch. Unklar ist, wer wir sein werden, die diese Zukunft gestalten: Gibt es in zehn Jahren noch ein Ich ohne Hilfsmittel? Und: Wäre das zu bedauern?