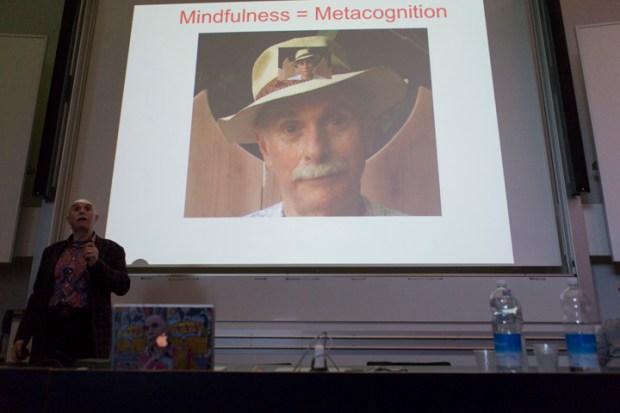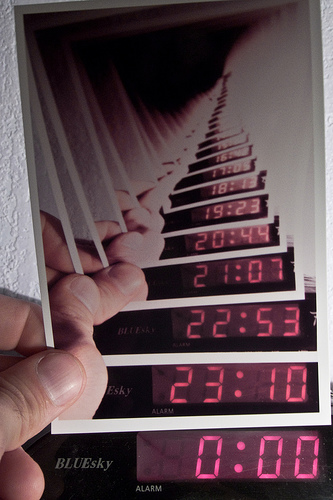Letzte Woche habe ich darüber geschrieben, wie ich Textverarbeitung gelernt habe. Die Idee dahinter ist, dass man darüber nachdenkt, wie man sich Kompetenzen konkret angeeignet hat, aus welchen Teilen sie bestehen und was man daraus über Lernprozesses ableiten kann.
Ich möchte daraus eine Blogparade machen: Das heißt andere Menschen bitten, auch Texte zu diesem Thema zu schreiben. Sinn davon ist, dass die Texte so besser sichtbar werden, die Bloggerinnen und Blogger sich so vernetzen und letztlich eine Sammlung von Texten entsteht, die ich dann in einem Schlusspost zusammenfasse und kommentiere. Der Titel der Blogposts wäre »Wie ich etwas gelernt habe«, wobei »etwas« dann ersetzt würde durch die Kompetenz. Eine mögliche Struktur der Beiträge wäre:
- Beschreibung der Kompetenz (was bedeutet es, das zu können?)
- Phasen des Lernprozesses
- Wie habe ich gelernt?
- Was lässt sich daraus übers Lernen ableiten?
Es ist Usus, einen Zeitraum vorzugeben: Ich schlage also mal vor, die Texte bis Ende April zu schreiben und würde mich freuen, wenn sie hier mit Kommentar verlinkt würden oder ich eine Mail mit einem Link erhielte.

Unten noch ein Beispiel von mir, weil ich darum gebeten wurde.
* * *
Wie ich gelernt habe, Texte zu schreiben.
(1) Bestandteile der Kompetenz
Es gibt viel Literatur zum Thema, aus welchen Bereichen die Kompetenz besteht, Texte verfassen zu können. Ich möchte hier nicht zu weit ausholen, sondern vier Aspekte betonen:
- Sich vorstellen können, was Texte beim Leser oder bei der Leserin auslösen.
- Die formale Gestaltung der geplanten Wirkung anpassen können.
- Die einzelnen Bestandteile des Textes (Wörter, Sätze, Abschnitte) formal und inhaltlich so gestalten, dass eine Orientierung im Text gewährleistet ist und die Rezeption des Textes erfolgreich erfolgen kann.
- Beim Verfassen des Textes die eigenen Gedanken ordnen und den Text auch für sich selbst schreiben.
Diese Bestandteile können nicht in dem Sinne gelernt werden, dass sie beherrscht werden und bei jedem neuen Text umfassend abgerufen werden können, sondern es findet lediglich eine Annäherung statt.
(2) Schulzeit
Ich habe immer viel gelesen und gern geschrieben. Das Schreiben fand im Deutschunterricht weit gehend frei von Vorgaben statt: Aufsätze erforderten hauptsächlich Kreativität. Oft wurden Texte von Schülerinnen und Schülern in der Klasse vorgelesen, dabei handelte es sich immer um stilistisch oder inhaltlich ausgefallene, an denen ich mich Orientierte. So entwickelte ich schnell einen eigenwillig, komplizierten Stil. Ich nahm Wörter aus meiner Lektüre und brachte sie in meinen Texten unter. Ich wollte hauptsächlich mit meiner Wortgewandtheit und meinen Kenntnissen beeindrucken.
Parallel dazu musste ich im Latein-, Griechisch- und Französischunterricht viel übersetzen. Mit der Zeit wurden wir dazu angehalten, stilistisch ansprechende Übersetzungen zu schreiben, also solche, die nicht primär genau waren, sondern sinngemäß. Texte zu schreiben, ohne den Inhalt erfinden zu müssen, zeigte mir klarer auf, was stilistisch möglich ist, welche Bandbreiten es gibt und wie Elemente eines Textes zusammenhängen.
Im Austauschjahr schrieb ich zum ersten Mal für eine Schülerzeitung. Begrenzte Zeit und begrenzter Raum waren neue Erfahrungen; zudem gab es klare Vorstellungen, wie ein guter Text einer Schülerzeitung auszusehen hatte (er sollte positiv sein, viele Namen und Aussagen enthalten und von Ereignissen an der Schule handeln). Die Schlussredaktion genoss ich enorm: Der zeitliche Druck wirkte anregend, wir schrieben viel und kritisierten heftig. Und danach hielten wir Ausdrucke in den Händen, welche die fertige Zeitung zeigten – auf die wir dann wiederum Feedback (auch von Unbekannten) erhielten. Es zeigte deutlich, wie Texte ankamen und wirkten.
Kurz vor der Matur hatte ich eine Freundin, mit der ich oft zusammenarbeitete. Sie pflegte, von ihrem Vater vermittelt, einen minimalistischen Stil: Knappe Sätze von hoher Klarheit. Sie las einige meiner Texte und kritisierte ihre stilistische Schwülstigkeit. Es fiel mir schwer einzusehen, dass sie Recht hatte – und ich begann zu vereinfachen. Und dazuzulernen.
(3) Studium
Immer mehr schrieb ich auch persönliche Texte. Die Verbreitung von Email zu Beginn meines Studiums führte dazu, dass ich Beziehungen über lange Texte aufzubauen begann. Ich spielte vermehrt mit Ausdrücken, versuchte eine persönliche Sprache zu finden; schrieb gleichzeitig aber auch über Alltägliches und immer mehr auch über meine Gedanken, auch Intimes kam zur Sprache. Ich lernte schon früh, Internetkommunikation als Mittel zu betrachten, Dinge zur Sprache zu bringen, über die ich mich in Gesprächen weder äußern konnte noch wollte.
Dazu musste ich längere Sachtexte schreiben. Dabei lernte ich zunächst kaum etwas dazu: Ich erhielt kaum Rückmeldungen auf Proseminar- und Seminararbeiten, allenfalls wurden ein paar Kommafehler korrigiert oder inhaltliche Kommentare abgegeben. Hilfreich war das Feedback meines Vaters, der als Volksschullehrer darauf pochte, dass ich nicht zu akademisch schrieb. Die Lektüre von Fachaufsätzen brachte mich immer wieder in Versuchung, ein Fachregister zu verwenden, hinter dem sich unklare Aussagen verstecken ließen.
Die Master- bzw. Lizarbeit stellte mich zum ersten Mal vor die Aufgabe, einen sehr langen Text zu schreiben. Schon während des Studiums hatte ich mir angewöhnt, sofort zu schreiben. Ich verarbeitete meine Lektüre sofort in Texte, die ich dann im Dokument platzierte und immer wieder verschob; während viele Kommilitoninnen und Kommilitonen die Arbeit an einem Stück schrieben, nachdem sie alle wichtigen Texte gelesen hatten. Schreiben wurde für mich schnell zum Mittel, eigene Erkenntnisse zu finden und Lektüre mit Reflexion zu koppeln.
(4) Bloggen und Social Media
Bis ich Social Media nutzte (mit Bloggen begann ich 2006) schrieb ich – mit Ausnahme von Schülerzeitungen – Texte, die meist genau eine Person lasen. Es waren Texte für mich, mit denen ich mich qualifizierte, die aber kein Publikum hatten. Das änderte sich. Zunächst war mein Blog sehr persönlich, es lasen einige Eingeweihte mit. Ich verstehe nicht ganz, wie und wann sie das Publikum erweiterte; eine Mischung von Facebook- und Twitter sowie Google-Suchen führte dazu, dass ich irgendwann einen Kreis von Leserinnen und Lesern hatte. Nicht viele, aber immerhin einige. Heute sind es wohl zwischen 100 und 200, die meine Texte auf dem Blog lesen; je nach Thema können es mehr sein. Die Wirkung der Öffentlichkeit verstehe ich aber nicht ganz: Ich erhalte mehr Feedback und merke sofort, wenn Texte nicht so wirken, wie ich es beabsichtigt habe. Ich kann stärker experimentieren – mal provozieren, mal verknappen, mal ausprobieren. Ich argumentiere parallel zu meinen Texten auch in Foren, auf Twitter, in Kommentaren – und erlebe den Unterschied zwischen den Texten, die ich auf meinen Kanälen veröffentliche, und denen, die auf fremden Kanälen erscheinen. Daraus ergibt sich die Bedeutung des Kontexts.
Entscheidend ist die Kürze, die vor allem von Twitter vorgegeben wird. Ich verzichte darauf, Abkürzungen zu verwenden und teile meine Tweets selten auf. So muss ich mich oft in 140 Zeichen ausdrücken. Viele Tweets lösche ich, formuliere neu, lösche Unnötiges. Mein Schreiben profitiert davon, zumindest denke ich das. Tweets wirken sofort, die Reaktionen zeigen Unklarheiten unmissverständlich auf. Zudem schreibt man viele davon, ich habe schon über 20’000 veröffentlicht, also ein Buch geschrieben.
Diese Menge ist ein anderer Faktor. Ich schreibe momentan pro Woche rund fünf Blogposts, insgesamt mehr als 300 Texte pro Jahr. Oft schreibe ich sehr schnell; ich nehme mir vor, einen Blogpost in 20 Minuten zu schreiben – erlaube mir dann aber, ihn zu ergänzen und zu überarbeiten. Texte werden so immer mehr zu etwas Provisorischem. Aus Blogposts entstehen Aufsätze, Aufsätze erscheinen zuerst als Blogposts.

(5) Wie habe ich gelernt?
Texte zu schreiben ist eine offensichtliche Kompetenz. In meinem Beruf als Lehrer, in der Schule und im Germanistik-Studium ist sie ständig explizit präsent. Texte werden besprochen und bewertet. Zunächst habe ich sicher dadurch gelernt, dass ich vielen Profis genau zugeschaut habe: Ich habe viele gute Texte gelesen und sie auf mich wirken lassen. Dabei habe ich auch allgemein über Texte nachgedacht und sie analysiert. Dabei wird klar, dass Begriffe definiert werden müssen, dass Abschnitte zu verbinden sind, dass Repetitionen oft wichtig sein können; Texte einen Rhythmus haben, nicht immer integral gelesen werden und es deshalb besonders exponierte Stellen gibt etc.
Ich habe viel imitiert. Nicht nur literarische Vorlagen, auch Journalistinnen und Journalisten, Sachtexte, sogar mündliche Äußerungen. Oft mit primitiven Tricks: Wörter und Sätze einfach übernehmen. Vergleichsideen klauen. Aufbaustrategien nachahmen.
Entscheidend ist weiter, sich Kritik auszusetzen. Leute zu finden, die eine andere Perspektive auf einen Text haben (z.B. mein Vater) und sie um ehrliches Feedback bitten. Ich war oft verärgert, ich fühlte mich unverstanden und war überzeugt von meinen Formulierungen. Aber ich habe eigentlich immer etwas geändert an meinen Texten. Heute freue ich mich über Rückmeldungen und beherzige sie immer. Auch das musste ich lernen – aber es war einfach: Überarbeitete Texte kamen besser an.
Und zuletzt: Einfach viel schreiben. Schreiben war für mich der Weg, Gelesenes und Gedachtes festzuhalten. Daraus habe ich eine Gewohnheit gemacht. Was Kleist über die Allmähliche Verfertigung von Gedanken beim Reden schreibt, gilt für mich fürs Schreiben:
Aber weil ich doch irgendeine dunkle Vorstellung habe, die mit dem, was ich suche, von fern her in einiger Verbindung steht, so prägt, wenn ich nur dreist damit den Anfang mache, das Gemüt, während die Rede fortschreitet, in der Notwendigkeit, dem Anfang nun auch ein Ende zu finden, jene verworrene Vorstellung zur völligen Deutlichkeit aus, dergestalt, daß die Erkenntnis zu meinem Erstaunen mit der Periode fertig ist.
(6) Kann man daraus etwas übers Lernen an sich ableiten?
Meine Erkenntnisse aus dem Textverarbeitungspost haben sich nicht wesentlich verändert, ich formuliere sie aber etwas anders und füge einen Punkt hinzu:
- Es hilft, eine Tätigkeit in verschiedenen Kontexten und unter verschiedenen Perspektiven auszuführen.
- Phasen von großer Freiheit und solche von großer Einschränkungen ergänzen einander und entfalten eine besondere Wirkung.
- Echte Kritik am eigenen Verhalten löst Lernprozesse aus.