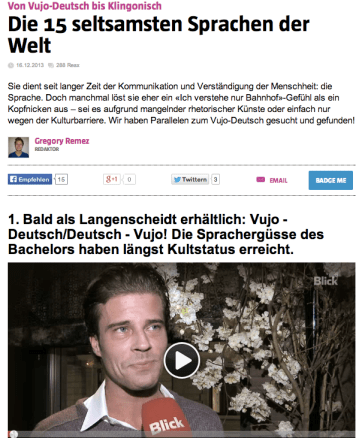Gestern erreichte mich eine Frage eines Lesers:
Sehr geehrter Herr Wampfler,
es ist erschreckend, denn leider hat sich mein Zeitungskonsum in den letzten Jahren sehr gewandelt. Richtig regelmäßig lese ich nur noch, Sie werden es ahnen: gar keine mehr. Glücklicherweise höre ich noch DLF.
Zeitungen wie taz, Süddeutsche, ZEIT, Spiegel, Brandeins lese ich nur noch sporadisch in Cafés und dann natürlich radikal selektiv. E-Paper hatte ich nur kurz von der FAZ, so richtig anfreunden konnte ich mich mit dem Zeitunglesen am Bildschirm nicht. Leider? Wie informiert man sich „richtig“?
Zudem habe ich immer wieder den Eindruck, nicht ausreichend informiert zu sein, obwohl ein großes Angebot am Kiosk oder auch an den oben genannten Orten zur Verfügung steht. Es ist schon seltsam, „früher“ hatte man als Leser klassischerweise ein bis zwei Zeitungen, schaute Tagesschau um Punkt 20 Uhr und war bestens informiert und konnte ruhig schlafen. Aber zu dieser Nutzungsweise kann ich auch nicht mehr zurückkehren, ich denke ich verpasse etwas.
Haben Sie für dieses Dilemma, dieses Problemfeld noch einen (letzten) Tipp für mich?
Besten Dank.
Meine Antwort heute Morgen:
Danke für Ihre interessante Frage.
Entscheidend scheint mir, ob Sie oder wir »früher« ausreichend oder richtig informiert waren, oder nur den Eindruck hatten, es zu sein. Im letzteren Fall wäre die Antwort ja einfach: Das moderne Subjekt definiert sich kulturhistorisch geradezu durch einen Mangel an Informiertheit. Es kann stets nur eine beschränkte Anzahl Perspektiven einnehmen – sein Bild der Welt ist notorisch einseitig und unvollständig.
Der erste Fall ist daher wohl der relevante. Er setzt voraus, dass es einen Medienkanon gibt, der jeweils in einem sozialen Umfeld bestimmt, was richtig Informiertsein bedeutet. »Früher« hieß das wohl, eine überregionale bildungsbürgerliche Zeitung lesen, eine regionale und die Tagesschau schauen. Alle fehlenden Informationen waren entweder dem Boulevard vorbehalten und damit einer ungebildeten Masse, oder erforderten ein spezifisches, meist akademisches Interesse.
Die Auflösung dieses Kanons durch die Digitalisierung kann man bedauern – ein Zurück gibt es kaum. Nur Strategien für das Jetzt und für die Zukunft. Ich liste einige auf:
- Flanieren. Sich immer wieder Zeit für Medien nehmen, beobachten, sich inspirieren lassen, aber nicht in Gewohnheiten verfallen, sondern beobachtend weitergehen. Mal eine Woche die FAZ lesen, einen Dokumentarfilm anschauen, Longform-Artikel aus dem englischen Sprachraum anklicken – immer wieder was anderes, fast Zufälliges. An nichts festhalten, aber für alles offen sein.
- Ein Netzwerk aufbauen. Weil ausreichend informiert sein letztlich nichts anderes bedeutet, als ausreichend informiert wirken, ist es sinnvoll das zu wissen, was die wichtigen Bezugspersonen wissen. Das Internet erlaubt uns, den Empfehlungen schlauer Menschen mit ähnlichen Interessen zu folgen. Wenn sich das linksliberale Milieu über einen Feuilletonartikel empört, dann erfahren das die meisten gut vernetzten Twitter-Nutzerinnen und -Nutzer. Wenn es neue bahnbrechende Forschung in der Neurowissenschaft gibt, werden entsprechende Foren und Google-Plus-Gruppen mit Zusammenfassungen und Interpretationen geflutet. Wer richtig vernetzt ist, darf auf die Kraft der Empfehlung vertrauen.
- Eine Nische suchen. Weil wir Informationen und Hintergründe zu Themen, die uns kurzfristig beschäftigen, sehr schnell abrufen können, ist es denkbar, auf eine breite Informationsbasis zu verzichten und sich zu spezialisieren. Die Publikationen lesen, in denen zwei, drei Fachgebiete differenziert behandelt werden. Tagesaktualitäten ignorieren. »News sind irrelevant«, schreibt Rolf Dobelli in einem lesenswerten Artikel.
Für mich funktioniert eine Mischung aus a.) -c.) gut. Habe ich den Eindruck, etwas Wichtiges verpasst zu haben, bin ich in einer halben Stunde mit meinem Laptop up-to-date. Das kommt aber weit seltener vor, als der Wunsch, Zeit zu haben, ein längst gelesenes Buch noch einmal zu lesen.
Das wäre mein Rat zum Schluss: Verwenden Sie die Zeit, die Sie früher für FAZ und Tagesschau aufgewendet haben, um ein Sachbuch oder einen Roman zu lesen.