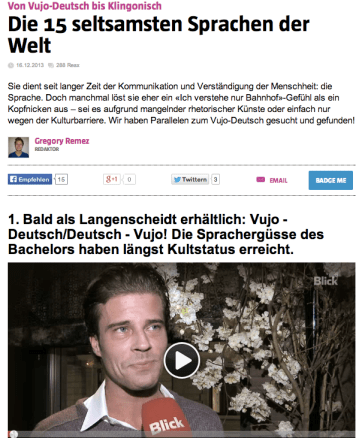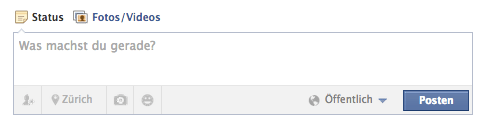Kürzlich habe ich hier im Blog kritisch darüber berichtet, dass die Swisscom um Schulen einen wirksamen Contentfilter anbieten zu können, mit Hilfe einer amerikanischen Firma verschlüsselte Kommunikation teil- und zeitweise entschlüsselt.
Auf meinen Blogpost erhielt ich viele Kommentare, unter anderem auch deswegen, weil der Blogpost für meine Verhältnisse oft gelesen und verlinkt wurde. Drei dieser Kommentare lasen sich wie folgt:


Die drei Kommentare nahmen klar zu einem Problem Stellung. Auf sozialen Netzwerken tauchte schnell die Frage auf, ob sie PR enthielten. Haben Verantwortliche bei der Swisscom aufgrund der Kritik diese Kommentare verfasst oder verfassen lassen?
In diesem Beitrag soll diese Frage nicht geklärt werden (der oberste Beitrag wurde von einer der Swisscom zugewiesenen IP-Adresse aus verfasst, was aber kein Beleg für oder gegen die These ist). Es geht auch nicht um die Swisscom, sondern um das allgemeine Problem, das PR im Netz für Menschen bedeutet, die mit Informationen lernen oder arbeiten.
Das Problem geht von einer Einsicht aus, die Brian Solis in seinen Büchern formuliert hat: Unternehmen können nicht länger Botschaften von Marketingabteilungen mittels Werbung aussenden, weil ihre Produkte durch die Möglichkeiten der Netzkommunikation konstant öffentlich bewertet und kommentiert werden. Um Vertrauen gegenüber einer Marke entstehen zu lassen, reicht eine Markengeschichte oder eine Inszenierung der Marke nicht aus, das Vertrauen wird häufig in der halb-öffentlichen Interaktion generiert.

Da sich Vertrauen häufig auch als soziales Phänomen ergibt, liegt es nahe, sich positiven Einfluss aufs Vertrauen zu kaufen. So lassen sich Profis anstellen, die:
- Kommentare schreiben
- Bewertungen abgeben
- Artikel schreiben
- Wikipedia füllen.
Im Anschluss an die These von Malcolm Gladwell, dass es Menschen gebe, welche einen besonderen Einfluss auf andere ausüben, werden insbesondere in Social Media aktive Menschen stark dazu angehalten, Werbung zu machen. So offeriert Zalando Bloggerinnen und Bloggern wie mir Gutscheine, wenn sie sie den Dienst ausprobieren und darüber schreiben, der Zürcher Künstler und Kurator Philipp Meier hat kürzlich von Microsoft ein Tablet geschenkt bekommen und Renato Mitra, der mit seinem Apfelblog bereits wenig Distanz zur Welt des Marketings zeigte, bloggt neu für Mini – als Gegenleistung darf er die Autos gratis fahren.

Mitra schreibt dazu im Impressum:
MINIBlog.ch wird nicht im Namen von MINI Switzerland geführt, sondern von der Privatperson Renato Mitra. Die Gestaltung, die Community wie auch inhaltliche Themen und Meinungen werden nicht von MINI Switzerland beeinflusst.
Meine eigene Erfahrung lassen mich daran zweifeln. Spätestens, wenn Mitra auf Sicherheitsprobleme von Minis aufmerksam machen möchte, dürfte der Druck, eine bestimmte inhaltliche Botschaft rüberzubringen, wachsen.
Gibt es ein Problem? Meier, Mitra und ich sind informierte Zeitgenossen. Wir können frei entscheiden, ob wir eine Entschädigung annehmen wollen und ob unsere Gegenleistung dafür angemessen ist (mein Verdacht ist, dass Social-Media-Akteure und -Akteurinnen oft einiges günstiger sind als professionelle Werberinnen und Werber). Und in all diesen drei Fällen wird der interessierten Leserschaft auch schnell deutlich, dass es sich um PR handelt – sie kann entsprechend reagieren (z.B. interessieren mich Mitras Kanäle nicht mehr, wenn sie mit Mini-Werbung gefüllt sind).
Aber letztlich produzieren wir Informationen, die verunreinigt sind. Was wir präsentieren, entspricht nicht mehr ganz unserer Haltung. Thema oder Instrumente sind vorgegeben. Jede Information hat potentiell eine PR-Komponente, die nicht in allen Fällen separat ausgewiesen wird. Wer dafür bezahlt wird, Wikipedia-Artikel zu schreiben, kann das dort nicht einmal vermerken. Wer im Auftrag von Unternehmen Kommentare in Newsportale oder Blogs abfüllt, soll das nicht vermerken.
Was dazu dient, Vertrauen in eine Marke zu erzeugen, schafft Misstrauen in Informationen von Fremden. Während Kommentare für mich ein ideales Mittel sind, auch harte Kritik abzuholen, weil ich Kommentierenden erlaube, das komplett anonym zu tun, so sind sie gleichzeitig auf ein ideales Mittel, auf meinem Blog Links und Meinungen zu platzieren, die nicht von den Kommentierenden, sondern von Unternehmen vertreten werden.
Eine Wertung lasse ich bewusst weg, sondern schließe mit der Beobachtung, dass gerade jungen Menschen oft das Gefühl abgeht, wie stark der Einfluss und wie gross die Möglichkeiten bezahlter PR sind.
 Das erste Zitat über die Papierabhängigkeit würde gut in diese Reihe passen, nur ist es nicht echt. Wie Quoteinvestigator rausgefunden hat, stammt es aus einem Artikel mit dem Titel »Probable Quotes From History« aus The MATYC Journal, 12/3, 1978 und zeigt in einer Liste von Zitaten, die alle mit »Student’s today…« beginnen, erfundene Zitate, wie Menschen hätten auch den technischen Wandel reagieren können.
Das erste Zitat über die Papierabhängigkeit würde gut in diese Reihe passen, nur ist es nicht echt. Wie Quoteinvestigator rausgefunden hat, stammt es aus einem Artikel mit dem Titel »Probable Quotes From History« aus The MATYC Journal, 12/3, 1978 und zeigt in einer Liste von Zitaten, die alle mit »Student’s today…« beginnen, erfundene Zitate, wie Menschen hätten auch den technischen Wandel reagieren können.