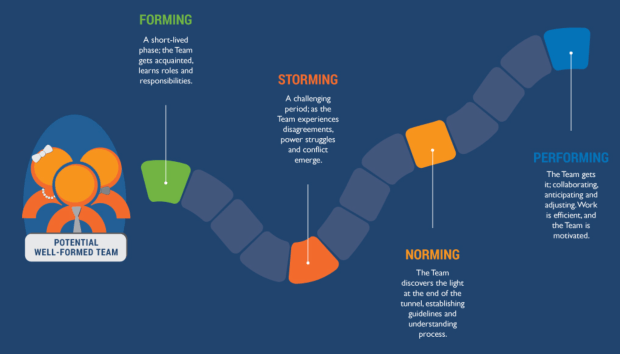Dieser Blogbeitrag ist zuerst bei Bold auf Englisch erschienen. Er ist auch eine schriftliche Version dessen, was ich an meinem Referat an der Didacta in Hannover ausgeführt habe. Die Bilder hier sind Slides von der Präsentation.
* * *
Heutige Lernformen sind nur dann erfolgreich, wenn sie sich neue Formen der Aufmerksamkeit zunutze machen
Im Studium habe ich pro Woche mindestens ein Buch gelesen, oft mehr. Ich las Sachbücher und Romane, aus Interesse, beruflichen Gründen und zur Unterhaltung. Die Lektüre fesselte mich. Seit ich digital lese, haben sich meine Lesegewohnheiten verändert: Immer wieder lege ich ein Buch zur Seite, um rasch etwas im Netz nachzuschlagen oder eine Nachricht zu beantworten.
Meine Aufmerksamkeit hat sich durch digitale Kommunikation verändert. Denken Menschen über die Auswirkungen der digitalen Kommunikation nach, gehört die Veränderung der Konzentration zu den häufig geäußerten Beobachtungen. In Marketing-Seminaren verbreitet sich eine Statistik: Die durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne eines Menschen sei von 12 Sekunden im Jahr 2000 auf unter 8 gesunken – sie sei sogar kürzer als die von Goldfischen.
Aus einer wissenschaftlichen Perspektive lässt sich die Veränderung der Aufmerksamkeit bestätigen – nicht jedoch die Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne. Die Psychologin Gemma Briggs analysiert den Zusammenhang wie folgt:
The average attention span is pretty meaningless. It’s very much task-dependent. How much attention we apply to a task will vary depending on what the task demand is.
Als Task hat sich meine Lektüre nicht verändert: Ein Roman erfordert heute keine andere Aufmerksamkeitsstruktur als früher. Doch meine Erwartung an die User Experience hat sich verändert: Sie wird, so zeigen Studien, von den zuvor wahrgenommenen Angeboten bestimmt. Schreibe und lese ich viele Texte in sozialen Netzwerken, dann enttäuscht ein Roman in seiner Form die aufgebauten Erwartungen an Interaktivität, Belohnung oder Kommunikation. Das dürfte der Grund sein, weshalb Social-Reading-Startups wie Sobooks oder Lectory versuchen, Social-Media-Funktionalitäten an Leseprozesse anzubinden.

Wie funktioniert Aufmerksamkeit im Netz?
Anders als Konzentration in der vordigitalen Zeit verarbeitet Aufmerksamkeit im Netz mehrere Reize parallel und fokussiert nicht auf einen Hauptreiz. Sie wägt ständig verschiedene Aktivitäten gegeneinander ab. Das geschieht bei der Verteilung von Aufmerksamkeit zwar ohnehin, doch Studien zeigen seit 10 Jahren eine starke Zunahme des Multitaskings, besonders in digitaler Kontexten. Zudem verläuft Aufmerksamkeit im Netz zyklisch: Virale Inhalte erhalten viel Aufmerksamkeit, weil diese auch nach sozialen Kriterien vergeben wird – ich nehme das wahr, was andere schon wahrgenommen haben. Dabei stehen Inhalte im Vordergrund, die von Algorithmen den Vorzug erhalten oder von Kampagnen platziert wurden.
Interagiere ich auf Social-Media-Plattformen mit Inhalten, vermischt sich Fremd- und Selbststeuerung meiner Aufmerksamkeit. Die Affordances der Plattformen, also das psychologische Angebot, das sie unterbreiten, führt dazu, dass Aufmerksamkeit sich auf Inhalte richten kann, ohne dass ich das bewusst steuere. Aufmerksamkeit im Netz ist zudem stark mit Feedback verbunden: Rezeption und Produktion vermischen sich und sind in kurzen Intervallen kurzgeschlossen.
Interaktive Plattformen funktionieren wie Slotmachines, die Spielsüchtige fesseln: Sie gaukeln ihnen ständig vor, bald den grossen Gewinn zu machen, von vielen Freunden Wertschätzung zu erhalten, die relevante Information vorgesetzt zu bekommen – und durch all dies eine hohe Zufriedenheit zu erreichen. Denn Aufmerksamkeit ist längst zu einer Währung geworden, wie Georg Franck schon 1998 in seinem Essay zur »Ökonomie der Aufmerksamkeit« vermutet hat. Sie wird auf einem Markt getauscht, ist damit mess- und verwertbar.
Die These vom User-Experience-Transfer besagt, dass die Eigenschaften der Netzaufmerksamkeit auf andere Lern- und Arbeitstasks übertragen werden. Lese ich meinen Roman, fühlt sich das ebenfalls so an, als investiere ich meine Aufmerksamkeit, als müsste es eine soziale und zyklische Form der Aufmerksamkeit geben. Und tatsächlich bietet Lesesoftware wie Kindle von Amazon die Möglichkeit, Stellen zu markieren, auf Twitter zu teilen und sich anzeigen zu lassen, welche Zitate andere hervorgehoben haben.
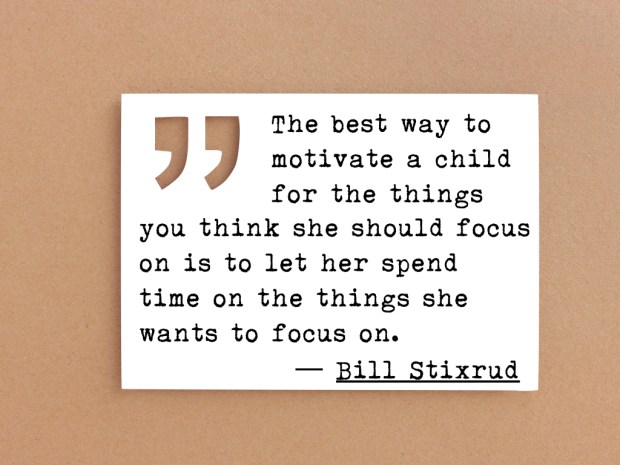
Die Lernangebote müssen auf dem Markt der Aufmerksamkeit mithalten
Wer Lernsettings designt und Menschen beim Lernen begleitet, muss diese Einsichten zur Kenntnis nehmen. Ich unterrichte seit 15 Jahren Deutsch an einem Gymnasium. Lese ich mit Schulklassen Bücher oder analysiere Filme mit ihnen, sind das Angebote, die eine bereits vorhandene breite Palette einfach zugänglicher Unterhaltungsmöglichkeiten lediglich ergänzen. Zwar war es schon immer so, dass sich Schüler mit Spielen oder Unterhaltungen abgelenkt haben. Digitale Medien sind jedoch oft professionell so gestaltet, dass sie die beanspruchte Aufmerksamkeit maximieren.
Kurz: Der Wert meiner Lernangebote ist auf dem Markt der Aufmerksamkeit gesunken. Von Serien, Games und Social Media geht eine Sogwirkung aus, die ich mit der Lektüre von Goethes «Faust» nicht erzeugen kann.
Sich eine andere Form von Aufmerksamkeit zu wünschen, ist verständlich – aber nutzlos. Hilfreicher ist es, digitale Formen von Aufmerksamkeitsverteilung in Lernsettings bewusst einzusetzen. Zum Beispiel mit Sketchnotes. Diese visualisierten Notizen erlauben Zuhörenden eine kreative Aktivität während eines Inputs. Ihre Aufmerksamkeit wird so intensiver.
Die soziale Komponente von Aufmerksamkeit lässt sich in Präsenzsettings einfügen, indem digitale genutzt werden. An Konferenzen nutzen Teilnehmende oft Twitter dafür. Bei Seminaren oder in Schulklassen imitieren Chatgruppen diese Technik: Wer sich nicht verbal mitteilen kann oder will, kann auf diesen Kanälen produktiv werden und gleichzeitig mitlesen, wie andere die Lernphase erleben.
Die Veränderung der Aufmerksamkeit durch digitale Plattformen lässt sich nicht aufhalten. Nostalgie ist verfehlt: Die menschliche Kognition passt sich der Umwelt an. Wie ich früher gelesen habe, ist nicht besser als wie ich heute lese.
Ich bilde mir nur ein, früher sei mein Leben weniger hektisch gewesen und ich hätte Inhalte tiefer verarbeitet. Dabei stehen mir auch heute Möglichkeiten zur Verfügung, intensiv zu lernen. Aber sie müssen erprobt und entwickelt werden, weil die Aufmerksamkeitsmechanismen des Web unsere Erwartungen erfolgreich prägen.