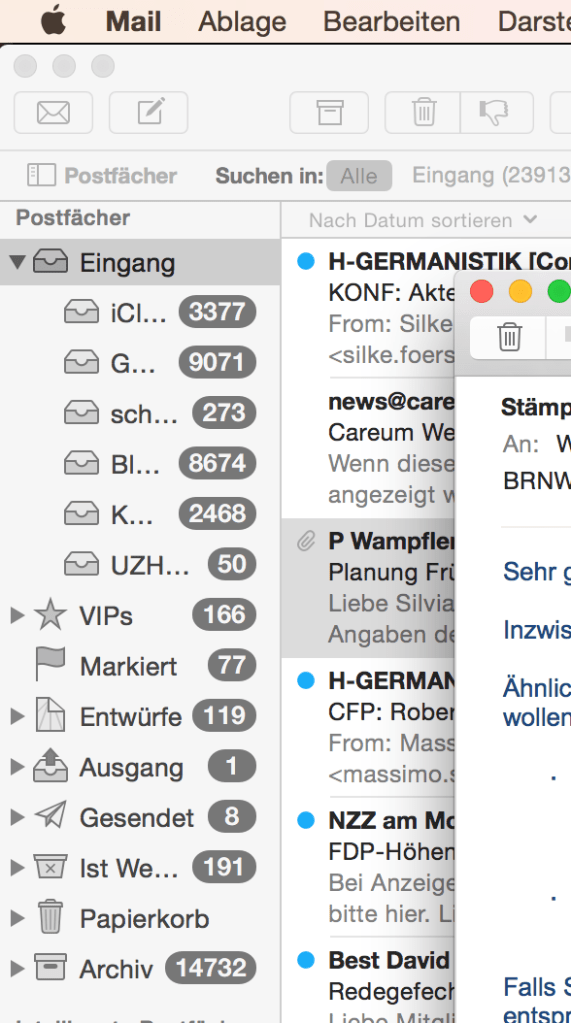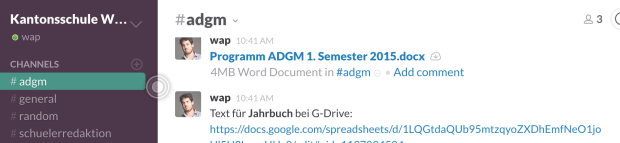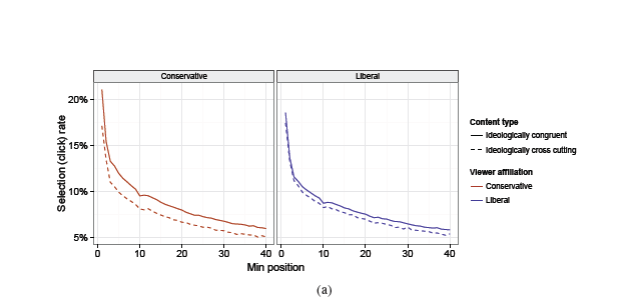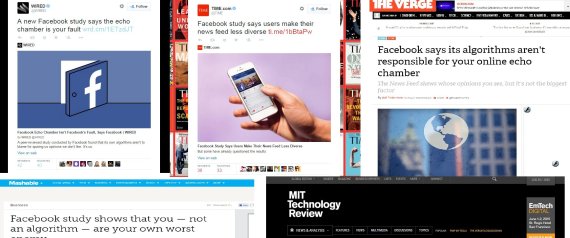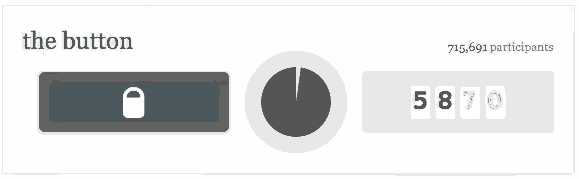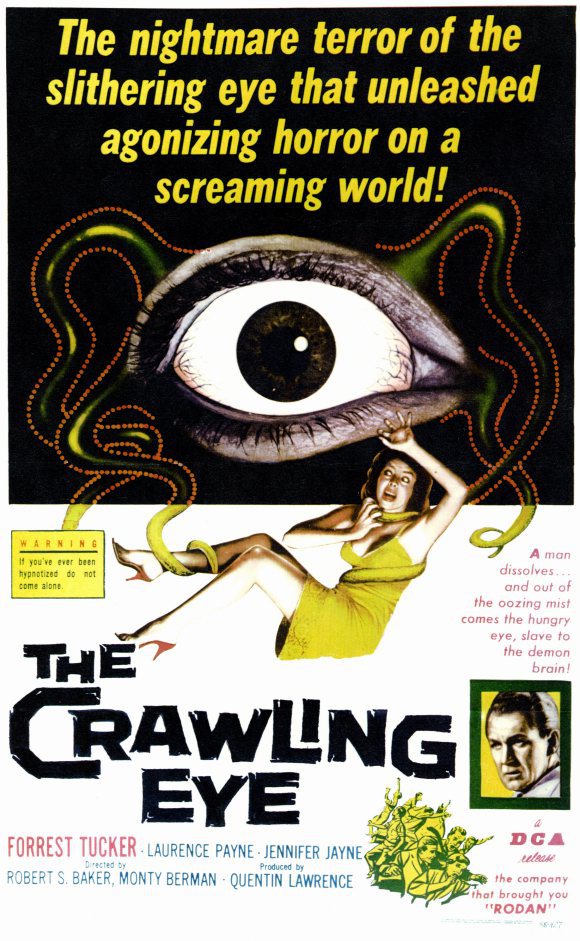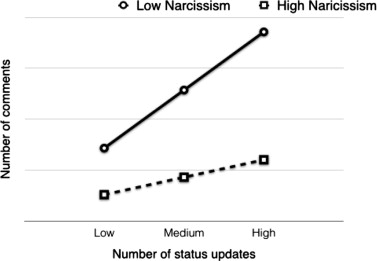E-Mails sind an Schulen zu einem Problem geworden (wahrscheinlich waren sie schon immer eines). Hier einige Facetten des Problems:
- E-Mails sind unübersichtlich.
In irgendeinem Anhang irgendeiner Mail finde ich den Link zu einem wichtigen Formular, das ich heute ausfüllen müsste. Aber wo? Geht noch so knapp mit OS X Spotlight oder der Mail-Suche von GMail, kriegt aber die durchschnittliche Lehrperson selten gebacken. Zu viel Zeit und Energie gehen mit der Suche nach grundlegenden Informationen verloren. - Too Much Information.
Multimail-Plattformen erlauben an Schulen Tätigen, schnell eine Zielgruppe auszuwählen und mit einer Mail zu bedienen. Das Prinzip ist aber dabei das engmaschige Fangnetz: Neben den eigentlichen Adressaten erhalten auch viele meine Mail, die damit nichts anfangen sollen oder müssen. Filter sind kaum möglich, weil diese Mails keinem System folgen, sondern genau so aussehen, wie wirklich wichtige Nachrichten. - Inbox Zero.
Mitglieder der Schulleitung arbeiten oft über eine Stunde pro Tag Maileingangsordner ab. Das hängt einerseits damit zusammen, dass das zu ihrer Aufgabe gehört – andererseits aber auch mit dem verbreiteten Muster, Probleme per Mail anderen zuzuspielen. An einer Schule: Der Instanz, die letztlich entscheiden kann. - Anhänge.
Mit Mails können Dokumente nicht kollaborativ bearbeitet werden, weil alle eine andere Version des Dokuments vor sich haben und Arbeitsschritte mehrfach erledigt werden. - (Mails laden zu Missverständnissen ein).
Das Problem hat sich im Vergleich zu vor fünf oder zehn Jahren massiv verbessert (das zumindest mein subjektiver Eindruck, viellicht habe aber auch ich mich verändert) – es besteht aber weiterhin: Mails eröffnen ein Spielfeld, auf dem jede und jeder Missverständnisse suchen kann. In einem Verein, gehen wir im Vorstand vom Prinzip aus, dass alles ohnehin missverstanden wird. Egal wie viel Mühe man sich beim Formulieren gibt. Das gilt auch für die Schule.
Es gibt Lösungsansätze zu diesem Problem. Sie bestehen generell aus folgenden Ideen:
- Verdichtung in Newslettern
Wer eine Mail an alle verschicken will, schickt sie stattdessen an eine Redaktion – die dann ein Mal pro Woche/Monat etc. einen schlau archivierbaren Newsletter verschickt - Kommunikation thematisch bündeln
Diskussionen direkt neben einem Dokument führen (z.B. bei Google Drive), statt Mail mit Anhängen zu verschicken; Threads zu eröffnen, bei denen alle alles lesen können, was es zu einem Thema zu sagen gibt - smarte Agendafunktionen
Informationen direkt an Kalenderevents anhängen, die dann auch auf Smartphones verfügbar sind - kollaborative Dokumente
Dokumente dort bearbeiten, wo sie gespeichert werden - zentraler Zugang zu dezentralen Aktivitäten
Metaoberflächen lassen Usern die freie Wahl, wie sie arbeiten wollen – ermöglichen aber allen einen Zugang dazu - smarte Suche
Google, Evernote und Apple verstehen etwas von Suchfunktionen – wer heute Wissensmanagement betreibt, muss alle Dokumente schnell nach Stichworten durchsuchen können
Slack ist im Moment wohl das Tool, das am meisten Verspricht. Anja Wagner nennt Slack die Lernplattform der Zukunft. In einer halben Stunde finden sich alle in Slack zurecht und können Fragen stellen, Dokumente hochladen und Kommentare abgeben. Slack durchsucht alle Files und Kommentare und ermöglicht die Anbindung einer Vielzahl von Apps, u.a. auch Google Drive. Teams verbinden sich in Kanälen, die themenspezifisch sind. Schulen könnten so leicht pro Klasse einen Kanal verwenden, den sie dann für pädagogische Gespräche während des Schuljahrs nutzen. Slack wäre nicht die Fileablage, sondern für den laufenden Austausch gedacht. Nicht die Kollaborationsplattform, sondern für den Verweis darauf und die Diskussion darüber.
Ich nutze Slack fleißig und hoffe, dass daraus eine Kultur entsteht. Schrittweise und langsam. Nicht als abrupter Mailersatz, sondern als langfristige Alternative.