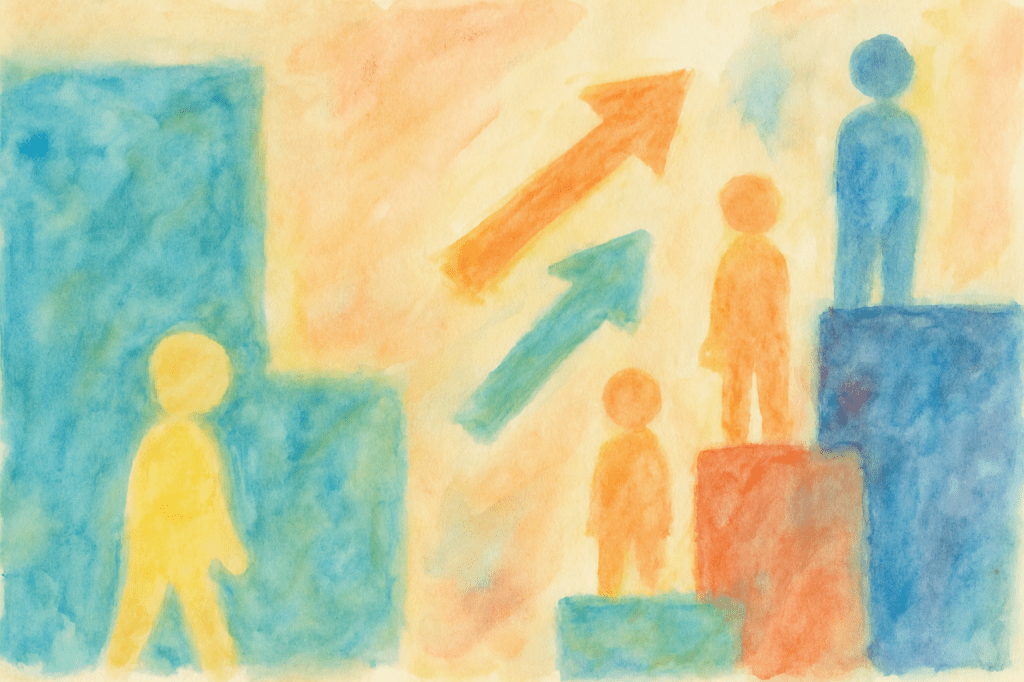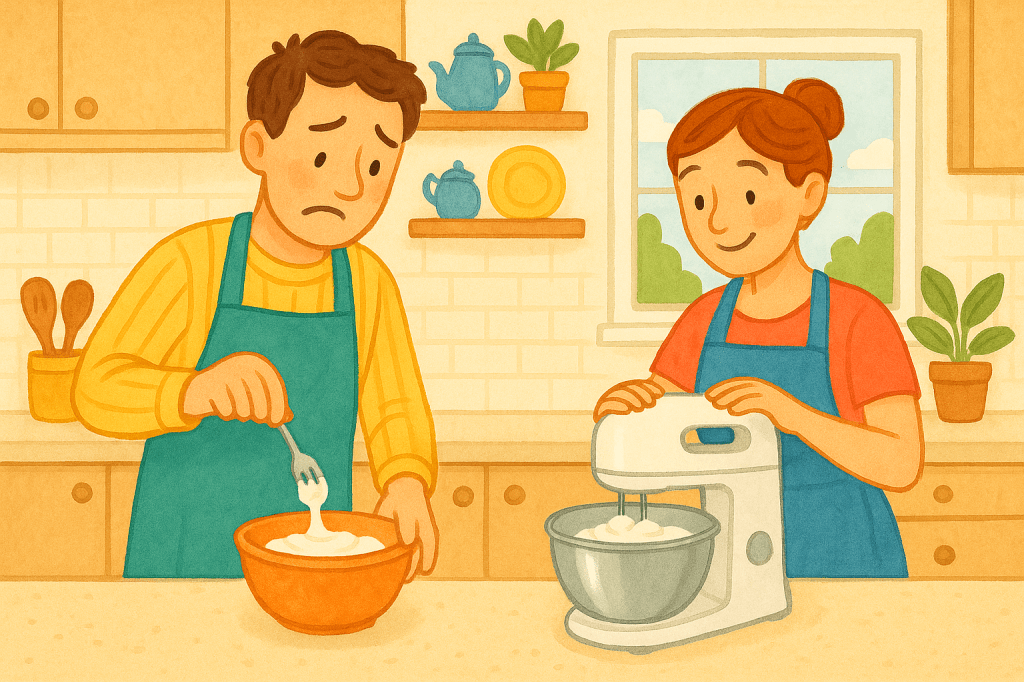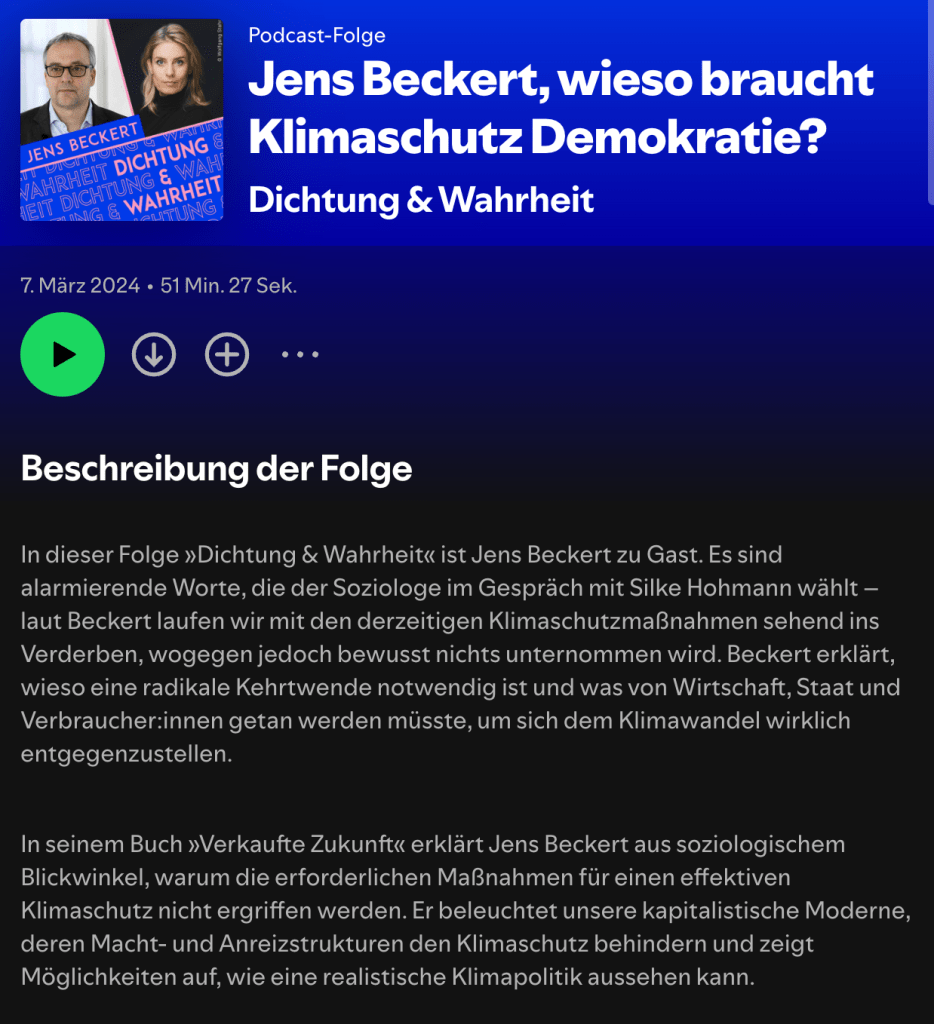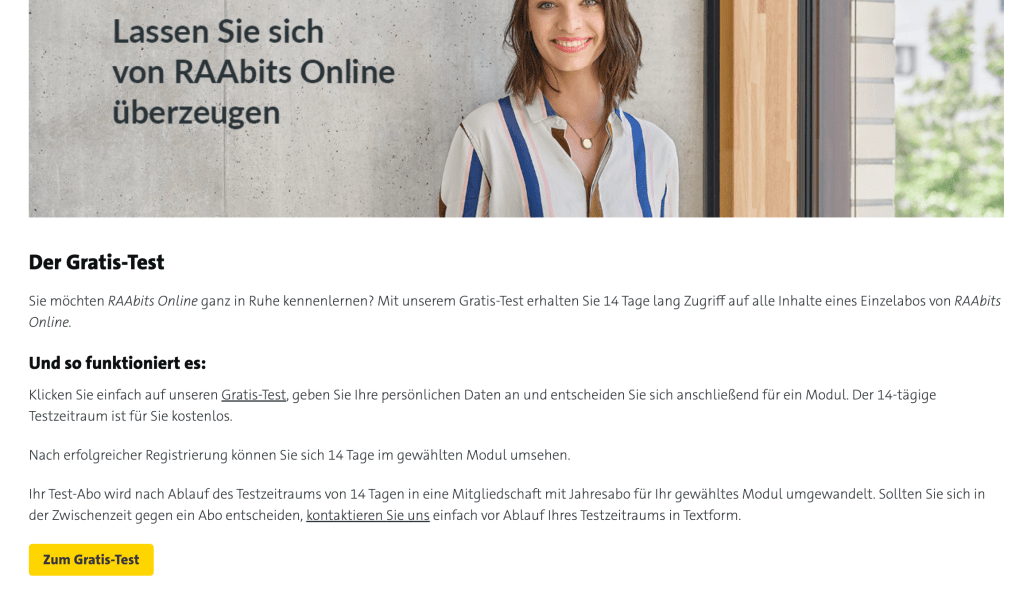Ein paar Jahre, nachdem ich mit Web 2.0 begonnen hatte, schien das Internet ein Wunder: Ich konnte praktisch allen Menschen beim Denken zusehen und mit ihnen ins Gespräch treten. Wenn etwas passierte, war ich quasi vor Ort und erhielt von klugen Menschen differenzierte Einordnungen. Wissenschaftliche Publikationen erschienen im Open-Access-Format, sharing war caring, Communities entwickelten vernünftige Regeln für zwischenmenschliche Interaktionen. Natürlich gabs im Netz schmuddlige Ecken, auch gefährliche – und Menschen, die weniger privilegiert waren als ich, fielen Vernetzung und Interaktionen weniger leicht. Das alles schienen aber lösbare Probleme zu sein. Ein sozial bewusster Einsatz der Technologie fühlte sich möglich an, der Fortschritt war spürbar.
Heute hat haben sich die Vorzeichen gedreht: Wenige Nischen ermöglichen den freien Austausch von Ideen, anregende und differenzierte Gespräche. Der Rest des Internets besteht aus algorithmisch ausgespieltem Content, der irgendwie monetarisiert werden soll – über Werbung, über Abos, über In-App-Käufe, über Shops. Was früher auf 4Chan oder Youtube absurde und realitätsfremde Sichtweisen waren, dass sich andere darüber amüsiert haben, wird heute von vielen Menschen geglaubt, geteilt, verteidigt. Verletzlichen Menschen wird nachgestellt, die Internet-Nutzung ist für sie eine Qual. Plattformen schützen sie kaum.
Selbst Wikipedia, ein ehrenwertes und tolles Projekt, wird mittlerweile von einer toxischen Community beherrscht, die Traditionen und schräge Normen über eine sinnvolle und faire Darstellung von Wissen stellt – und gleichzeitig durch die Entwicklung der Plattformen massiv bedroht wird.
Wie konnte es soweit kommen?
Ich kann drei Hypothesen anbieten: Erstens könnte es sein, dass ich alt und kulturpessimistisch werden. Möglicherweise war das alles schon immer so, ich habe mir einfach eingeredet, es wäre besser oder anders.
Zweitens bietet das Internet allen Menschen Erlaubnisstrukturen an, um ihr problematischen Vorlieben und Tendenzen auszuleben. Den Begriff der Erlaubnisstruktur hat Barack Obama eingeführt. Mit «permission structure» bezog er sich auf seine politischen Gegner, die eigentlich gerne seine Politik unterstützen würden, durch bestimmte Normen aber davon abgehalten würden. Obama sah es als sinnvolle politische Strategie an, emotionale Erlaubnisstrukturen zu schaffen, die es für Republikaner möglich machten, demokratische Vorschläge zu akzeptieren. Die Trump-Kampagnen hat in ihrer politischen Arbeit diese Strategie umgedreht: Ging es Obama darum, Menschen zu ermöglichen, das zu tun, was sie für richtig halten, schuf Trump Möglichkeiten für Menschen, Impulsen nachzugeben, obwohl sie wissen, dass diese nicht richtig sind. Die rechte Erlaubnisstruktur sagt, dass Rassismus, Sexismus, Ausbeutung, Diktatur etc. irgendwie in Ordnung sind.
Diese Art von Erlaubnisstruktur bietet das Internet allen Menschen an. Wenn sie Google nutzen, sich digitale Plattformen ansehen oder KI-Tools einsetzen: Sie erhalten überall die Bestätigung, dass sie mit ihren hässlichen, problematischen Seiten nicht allein sind, sich weder ändern noch schämen müssen für das, was sie im Alltag meist nicht laut sagen würden. Die schräge Idee, dass Meinungsfreiheit bedeutet, problematische Sachen aussprechen zu dürfen, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen und ohne dafür kritisiert zu werden, ist die fundamentale Eigenschaft der Netz-Erfahrung. Die Erlaubnisstruktur besteht erstens aus Content, der die eigene Position untermauert und sie attraktiv dastehen lässt. Zweitens funktioniert sie über eine Community, in der andere Menschen einen darin bestätigen, die Welt richtig zu sehen. Drittens wird sie algorithmisch verstärkt, die Internet-Nutzung wird so optimiert, dass unsere unreflektierten Impulse bedient werden.
Wer nicht in ein diverses soziales Netzwerk eingebunden ist, viel Lebenserfahrung hat oder sich in den persönlichen Werten sehr sicher ist, wird mit diesen Erlaubnisstrukturen kaum zurecht kommen. Das hängt auch mit dem dritten Aspekt zusammen:
Dem Kapitalismus. Im Studium habe ich gelernt, dass der Kapitalismus jeden Widerstand in sich aufnehmen kann. Das Beispiel war damals die Punk-Bewegung, die viele kapitalistische Prämissen abgelehnt hat. Der Kapitalismus hat Punk zu einem Produkt gemacht: Man konnte Jacken, Sticker, Alben etc. kaufen, die Ideologie konsumieren. Es war möglich, damit Geld zu verdienen oder sich mit Geld einzukaufen. Das hat der Bewegung jede Kraft genommen. Ähnlich ist es mit dem Netz: Die Vorstellung, Inhalte und Programme kostenlos digital zu teilen, ist radikal antikapitalistisch. Eine seriöse Informationsethik geht davon aus, dass Informationen nicht über Bezahlschranken verteilt werden, dass sie auch nicht ein Weg sind, mit dem Menschen Geld verdienen sollen. Deshalb haben in der Blüte des Web 2.0 viele Menschen kostenlos gearbeitet und digitale Allmende gebildet, in denen Wert entstanden ist, der digital nicht verwertet werden konnte.
Auch das hat der Kapitalismus absorbiert – und zwar relativ einfach: Wer mit seinen Inhalten Aufmerksamkeit generiert, wird heute zum «Content Creator». Die geleistete Arbeit kann monetarisiert werden: Wer auf Instagram genügend Follower hat, wird an Events eingeladen, kriegt Kleider zugeschickt und erhält Anfragen, ob man nicht die eine oder andere Dienstleistung testen möchte. Grundsätzlich gibt es eine permanente kapitalistische Erlaubnisstruktur: Menschen finden Gründe, um alles in Content zu verwandeln und diesen Content zu vermarkten – z.B. ihre Tätigkeiten als Lehrpersonen. Pädagogischer Populismus lebt stark davon, dass es ein Geschäftsmodell gibt, das Lehrpersonen erlaubt, ihre pädagogischen Ideale zu vergessen und schamlos das anzupreisen, was andere scheinbar hören wollen.
Kürzlich habe ich eine Aussage von Kaspar Surber gelesen, der sagt, die WoZ sei deshalb eine gute Zeitung, weil sie den Erfolg von Beiträgen nicht in Klicks messe, sondern echte Relevanz anstrebe. Die aktuelle Version der digitalen Kommunikation macht es möglich, echte Haltungen und Werte, differenzierte Erkenntnis und Gespräche und eine vertiefte Auseinandersetzung durch Bestätigung, Reichweite und Verwertbarkeit zu übersteuern – und so eine permanente Erlaubnisstruktur für alles zu erhalten.
Einzelnen Menschen kann man nur bedingt einen Vorwurf machen: Einen moralischen Kompass muss man sich leisten können, sowohl finanziell wie auch sozial. Das heute sichtbare Problem gab es wohl schon immer, nur waren in der Zeit, welche ich als Blüte bezeichnen würde, primär privilegierte Menschen im Netz. In der Covid-Zeit haben alle online gelebt – und zu viele konnten nur schlecht mit den Erlaubnisstrukturen umgehen. Nun haben wir ein Internet, das Informationen und Beziehungen zu Content macht – also alles in eine Form bringt, die vermarktet und verkauft werden kann.
Ich schliesse nicht mit Hinweisen, wie man die Situation verbessern könnte. Die Erlaubnisstrukturen sind alle da – wenn ich eine Community finden will, die mir sagt, Impfungen seien schädlich, Pferdemedikamente toll, Verschwörungserzählungen wahr oder böse Menschen eigentlich gar nicht böse, dann kann finde ich die heute auf meinem Smartphone. Damit kann eine Gesellschaft, die wie unserer organisiert ist, wohl nicht sehr gut umgehen.