Was folgt, ist weder ein Erfahrungsbericht noch eine Anleitung. Die Gedankengänge bilden einen Essay, mit dem ich zum Weiterdenken und Widersprechen einladen möchte. Im Kern geht es um die Frage, wie digitale Technik und pädagogisches Handeln verbunden sind – wie hängen sie zusammen, wie wirken sie gegenseitig aufeinander ein, was für Probleme entstehen durch die Kombination?
Was ist Technik in einer Kultur der Digitalität?
Die »Idee der Technik« bestehe darin, »ein Höchstmaß an Effekt und Machtkonzentration mit einem Mindestaufwand an menschlicher Kraftinvestierung« zu verbinden, heißt es in Die Frist von Günther Anders (1980). In diesem Verständnis würde Technik dazu dienen, menschliche Energie durch maschinelle zu ersetzen; die Wirkung von Handlungen zu verstärken und dabei den Aufwand zu reduzieren.
Unter dem Einfluss der Atomtechnik skizziert der Philosoph einen dystopischen Endzustand:
»Die beste [Maschine] aber wäre diejenige, die nicht nur die Beteiligung des Menschen überflüssig machen würde (mindestens die Beteiligung des Menschen als Menschen), sondern auch die Existenz anderer Maschinen, aller anderen: um als einziger und absolut alleinherrschender Behemoth alle denkbaren Leistungen in sich zu vereinigen und zu verrichten.« (ebd.)

Wenn wir von diesem Technikverständnis und der damit verbundenen Gefahr ausgehen, dann stellt sich die Frage, was die Konsequenzen für die digitale Transformation sind. Felix Stalder hält fest, im Zug dieses Wandels hin zu einer Kultur der Digitalität sei »eine neue Infrastruktur der Wahrnehmung, der Kommunikation und der Koordination« entstanden. Dabei betont er eine Differenz zwischen Technik und sozialen, wirtschaftlichen und politischen Vorgängen: Schon der Titel seines Essays macht das deutlich: Herausforderungen der Digitalität jenseits der Technologie. Stalders präzise Argumentation lautet wie folgt:
»Angetrieben wird diese Entwicklung jedoch nicht von der Technologie als solches, sondern durch vielfältige soziale, ökonomische und politische Entwicklungen, die aus jeweils unterschiedlichen Gründen die Komplexität der Gesellschaft erhöhen und neue Verfahren des Umgangs mit dieser Komplexität erfordern. In fast allen diesen Verfahren spielt Technologie eine wichtige Rolle, denn sie erlaubt es, die stark steigende Volumina an Daten und Kommunikation bewältigen zu können und neue Formen des Handelns in der Welt zu entwickeln.«
Hier wird deutlich, wie Stalders Perspektive zu interpretieren ist: Die Technik entsteht aus nicht-technischen Gründen und hat nicht-technische Konsequenzen. Nimmt man die Definition von Anders und kombiniert sie mit der Unterscheidung von Stalder so entsteht eine Art Modell:
Handeln in der Welt führt zum Bedürfnis nach größerer Effizienz (mit weniger Arbeitszeit mehr Essen produzieren, mit weniger Zeit vor dem Bildschirm mehr Daten verarbeiten). Dieses Bedürfnis führt zur Entwicklung von Technologie. Das hat im Rahmen der digitalen Transformation drei Konsequenzen:
- Technik erzeugt eine Tendenz, eine Eigendynamik: Weil es möglich ist, Handeln technologisch effizienter zu machen, könnte (oder sollte) das auch in anderen Bereichen des menschlichen Handelns gemacht werden.
- Mit der Effizienz steigt die Komplexität. Das ist nicht nur deshalb so, weil maschinell unterstützte Handlungen per se komplexer sind als Handlungen ohne Technikeinsatz, sondern auch deshalb, weil Technikeinsatz im Rahmen einer gesellschaftlichen Entwicklung erfolgt, die Technik als Bewältigung dieser Komplexität sieht.
- Digitale Technologie verändert Gesellschaft, sie führt zu anderen Formen der Wahrnehmung, der Kommunikation, der Beziehung.
Diese drei Konsequenzen lassen sich an einem Beispiel verdeutlichen: Online-Dating. Die Vorstellung, Partnervermittlung maschinell zu unterstützen, hat eine lange Geschichte. Seit den 1960er-Jahren gibt es entsprechende Verfahren, die eingesetzt werden. Das Verfahren des »Matchings«, also der Suche nach Daten, die es erlauben, zwei Profile einander so zuzuordnen, dass sie dann auch zueinander passen, ist die Grundlage dieser Technologie. Das Verfahren hat nun eine Eigendynamik ausgelöst: Sehr viele digitale Verfahren »matchen« Profile und erzeugen so Empfehlungen, spielen Werbeanzeigen aus, treffen eine Auswahl etc. Das ist die Tendenz, welche Technik erzeugt.
Die Komplexität lässt sich bei Online-Dating bei der Frage festmachen, wie »Matching« vorgenommen wird. Die ersten Verfahren gingen davon aus, dass Profile zueinander passen, welche ähnliche Antworten auf Fragen geben. Mittlerweile sammeln Plattformen Daten der User*innen, aus denen sie Korrelationen ableiten, die nicht notwendigerweise erklärbar sein müssen. So konnten Paare generiert werden, die nicht ähnlich waren, sondern deren Eigenschaften und Erwartungen kompatibel waren. (Aus der Datenauswertung bei OKCupid entstand beispielsweise 2011 die Vermutung, dass Frauen, die Bier mögen, oft beim ersten Date Sex hätten.) Dieses Daten-Matching wird bei Tinder-ähnlichen Plattformen erweitert: Durch Lokalisierungsdaten, Bewertung des Aussehens, Chat-Interaktion. In Zukunft werden wohl Programme angeboten, welche User durch den ganzen Dating-Prozess hindurch begleiten (z.B. AIMM) oder DNA-Daten auswerten.
All das hat gesellschaftliche Auswirkungen: Die Vorstellung, wer zu einem passt, wie eine Beziehung beginnt, sich entwickeln sollte, endet – all das ist mit Technologie verbunden. Beziehungsarbeit erfolgt ebenso mit technologischer Unterstützung, die Wahrnehmung von Beziehung bezieht maschinelle Verfahren mit ein…
Ein Zitat von James Bridle bringt die Erkenntnisse aus der Betrachtung dieses Beispiels auf den Punkt: »In the end, the development of online dating tells us more about our relationship with networked technology than with each other.« Die Plattformen beeinflussen menschliche Vorstellungen von Beziehungen, sie entwickeln eine technische Definition von »Matching«, von zueinander passen. Die Technik entsteht aus menschlichem Handeln, beeinflusst dieses Handeln und schafft einen Rahmen für Anschlusshandlungen: Wer heute Dating betreiben möchte, muss sich zu Online-Dating verhalten, muss die Wirkung dieser Programme kennen oder zumindest berücksichtigen.
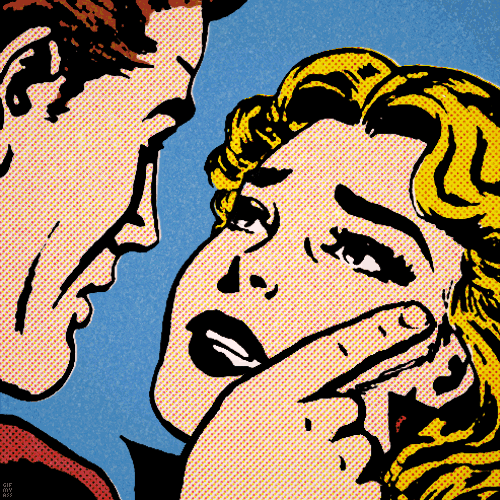
Technik ermöglich Menschen effizienteres Handeln, erhöht aber gleichzeitig die Komplexität von Handlungen und modifiziert die Handlungen. In ihrer digitalen Ausprägung verändert sie Gesellschaft, Wahrnehmung, Beziehungen, Wirtschaft und Politik. Ihre Benutzung ist – um auf ein Zitat von Hannah Arendt zurückzugreifen – nicht frei, sondern schafft Sachzwänge und verändert Menschen:
»Die Apparate, die wir einst frei handhabten, fangen in der Tat an, so zu unserem biologischen Leben zu gehören, daß es ist, als gehöre die menschliche Spezies nicht mehr zur Gattung der Säugetiere, sondern beginne, sich in eine Art Schaltier zu verwandeln. Es kann so aussehen, als ob die Apparate, von denen wir überall umgeben sind, ebenso unvermeidlich zum Menschen gehörten wie das Schneckenhaus zur Schnecke und das Netz zur Spinne.«
Pädagogik und Technik: Zwei Bilder
Nachdem nun umrissen ist, was unter Technik zu verstehen ist, soll das Verhältnis von Technik und Pädagogik in den Blick rücken. Ausgangspunkt sind zwei Bilder aus der Schule, an der ich unterrichte. Das zweite stammt aus meinem Unterricht, das erste wurde zu einer Zeit aufgenommen, als ich die Grundschule besucht habe.


Die beiden Bilder zeigen den Beginn und den Abschluss einer Entwicklung: 1985 wurden Schulzimmer mit Computern ausgestattet, 35 Jahre später werden die letzten Computerzimmer aufgelöst. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an Gymnasien immer stärker mit ihre privaten Geräten: BYOD heißt das Schlagwort, »bring your own device«.
Die Unterschiede bei der Benutzung digitaler Geräte ist augenfällig: Sitzen die Schülerinnen im aktuellen Bild so, dass sie zusammenarbeiten können, so war das 1985 nicht erforderlich. Die Haltung der Lernenden war auf das Gerät fixiert. Die Computertechnik war nicht effizient genug, um die nötigen Freiheitsgrade zu erlauben – wer im Informatikraum Korrespondenz lernen wollte, muss eine bestimmte Haltung einnehmen und Vorgaben korrekt umsetzen.
Die Handys der Schülerinnen in meinem Deutschunterricht gehörten zu ihnen, wie Häuser zu Weinbergschnecken. Sie haben die Verfahren, wie man mit Smartphones schreibt, liest, kommuniziert oft selbst entdeckt. Zuweilen bemerken sie amüsiert, eine Mutter oder ein Onkel habe entdeckt, dass man auf Smartphones mit zwei Händen schneller tippen könne. Das Mehrhand-System ist das 10-Fingersystem der BYOD-Generation: Ein Verfahren, das informell von jungen Menschen gelernt wird, im Gegensatz zu einer Kulturtechnik, die angeleitet, gelehrt und geprüft wurde.
Die Bilder zeigen ein Spektrum in Bezug auf das Verhältnis von Technik und Pädagogik. Sie führen vor, dass hier keine einfachen Kausalitäten zu entdecken sein dürften, sondern dass
- Technik erst im Kontext einer bestimmten Pädagogik eine konkrete Wirkung entfaltet.
- Pädagogik erst im Kontext einer bestimmten Technik eine konkrete Wirkung entfaltet.
Zum Bild von 2020 gehört ein Bild von mir, dem Lehrer der Klasse. Darauf wird deutlich, was alles zur Technik gehört meinen Schulzimmern: Eine Wandtafel mit Putzer, ein Tonabspielgerät (das ich nie benutze), eine Fernsteuerung zum Projektor, ein privater Laptop mit Ladekabel, ein fix installierter Laptop, ein HDMI-Kabel, gedruckte Bücher und Stifte. Dieses Setting kann erweitert, verkleinert, verändert werden. All das hat einen Einfluss auf die Pädagogik.

Und was kommt jetzt zuerst?
Ein Buch von Klaus Zierer trägt den Titel: Lernen 4.0 – Pädagogik vor Technik. In der Beschreibung des Verlags heißt es:
»Zentral ist dabei die These, dass Digitalisierung als Strukturmaßnahme wenig bringen wird. Denn viel wichtiger sind die Menschen, die diese Strukturen zum Leben erwecken. Also: Pädagogik vor Technik!«
Der Slogan »Pädagogik vor Technik« ruft dazu auf, zuerst pädagogische Fragen zu klären, bevor technische überhaupt erst gestellt werden (und bevor eine Veränderung eingeleitet wird). Weil es Menschen sind (oder sein sollten), die sich pädagogisch entfalten, müsste ihrem Handeln (was dann wohl die Pädagogik wäre), Vorrang eingeräumt werden.
Da sich aber Pädagogik in technischen Settings abspielt – und Technik in pädagogischen – ist dieser Vorrang eine Täuschung oder ein Trick. Eine Täuschung ist er dann, wenn man nicht bemerkt, dass pädagogische Entscheide von technischen Voraussetzungen abhängen. Wenn ich meine Klassen dazu anrege, ein Kleingruppen Probleme zu bearbeiten und sich dabei einander zuzuwenden statt zur Wandtafel zu schauen, dann bedingt dieser Entscheid, dass sie nicht in einen fix installierten Röhrenmonitor schauen, wenn sie sich nach hinten drehen. Im Computerzimmer von 1985 hätte ich anders entschieden, anders gehandelt.
Ein Trick ist der Slogan »Pädagogik vor Technik!« dann, wenn damit suggeriert werden sollte, die Technik müsse zuerst auf dem aktuellen Stand bleiben, um damit bestimmte pädagogische Entscheide zu beeinflussen.
Axel Krommer hat die Implikationen der Forderung »Pädagogik vor Technik« genauer untersucht. Er schreibt (Literaturverweise entfernt):
»Der wahre Mehrwert digitaler Medien besteht also nicht darin, alte Ziele schneller zu erreichen, sondern völlig neue Zieldimensionen erstmals zu erschließen. Das Motto »Pädagogik vor Technik« verstellt nicht nur den Blick auf diese Zusammenhänge, sondern auch auf die radikal-disruptiven Veränderungen, die für die Phase der Leitmedientransformationprägend sind: Es geht darum, dass die gesamte Gesellschaft durch die Kultur der Digitalität in eine neue Denk-Nährlösung […] getaucht wird, in der auch solche Begriffe wie Lernen und Wissen neue Bedeutungen erhalten. Aus der »Pädagogik vor Technik«-Perspektive bleiben diese komplexen Interdependenzen, die für das Verständnis der Kultur der Digitalität und der Veränderungen im Bereich des Lernens und Lehrens entscheidend sind, weitgehend unsichtbar.«
Das Fazit dieser Überlegungen lautet: Technik und Pädagogik können in einem Veränderungsprozess nicht getrennt werden. Technik beeinflusst Wahrnehmung, Denken, Wissen, Lernen. Erfolgt hier ein disruptiver Wandel, muss das pädagogische Folgen haben – genau so wie eine pädagogische Revolution technische Konsequenzen hätte.
Was bedeutet eine Kultur der Digitalität für die Pädagogik?
Stalders Begriff der »Kultur der Digitalität« verweist darauf, dass Digitaltechnik nicht-technische Veränderungen auslöst. Diese betreffen praktisch alle Bereiche der Pädagogik, die hier als Praxis des schulischen Lernen verstanden wird: Wie Erklärungen, Gespräche, Disziplin, Kontrolle, Aufmerksamkeit, Wissen etc. funktionieren, ist vor und nach der digitalen Transformation anders.
Betrachten wir das Gespräch: Menschen sprechen miteinander. Nun haben diese Menschen aber alle ein Smartphone. Wann schauen sie drauf? Wann schlagen sie etwas nach? Wann benutzen sie Apps, welche das Gespräch unterstützen? (Die oben erwähnte Dating-App AIMM macht auch Vorschläge für Gesprächsthemen.) Das alles hat einen Einfluss auf ein Gespräch. Auch wenn im Schulraum ein Verzicht auf Smartphones erzwungen wird – in meinen Räumen ist das nicht der Fall, wie das NZZ-Bild zeigt: Ein Gespräch mit einem erzwungenen Verzicht ist nicht dasselbe wie ein Gespräch ohne diesen Verzicht.
Während des Corona-Homeschoolings finden einige Unterrichtsgespräche als Videokonferenzen statt. In der ersten Phase was er ein lustiger Streich von pubertierenden Männern, in Teams anderen das Mikrofon stummzuschalten während einer Konferenz oder in Zoom verstörende Hintergrundbilder einzustellen. Das digitale Settings führt zu neuen Formen des Störens und zu neuen Formen der Disziplin – die zunächst einfach darin besteht, ein striktes Rechtemanagement einzuführen. Wie auf Schul- und Geschäftscomputern eingestellt wird, was im Internet abrufbar ist und was nicht, wird bei Videokonferenzen festgelegt, was Teilnehmende tun dürfen und was nicht. Pädagogik besteht auch in Kontrolle, in digital unterstützter Autorität. Was bislang noch wenig Beachtung fand, sind die anfallenden Daten und ihre Auswertung. In Videokonferenzen wird die Aktivität der Teilnehmenden vermessen. In einigen Tools ist es leicht, auf diese Daten zuzugreifen und sie z.B. als Ausgangslage für Beurteilungen zu benutzen.

Das hat Konsequenzen für Unterrichtsgespräche: Technisch ist es auch da möglich, Redeanteile statistisch auszuwerten, sogar die Tonlage von Beiträgen zu erheben (um etwa Fragen von Antworten unterscheiden, positive und negative Wortmeldungen zu erhaben). So könnten digitale Assistenzgeräte Lehrkräften mit diesen Daten helfen, Unterrichtsgespräche zu verbessern, Bewertungen vorzunehmen etc.
Gespräche werden also durch digitale Endgeräte erweitert und vermessen. Wie einleitend vermerkt steigert das scheinbar die Effizienz von Gesprächshandlungen, erhöht dabei aber insbesondere die Komplexität und führt zu neuen Probleme, die wiederum Handlungen erfordern. Wann spreche ich in einer Videokonferenz, wenn ich weiß, dass die Gesprächsdauer vermessen und ausgewertet wird? Wann stelle ich eine Frage, wenn ein digitaler Gesprächsapparat registriert, wer wie oft eine Frage stellt? Wann greife ich auf digitale Ressourcen zu, wenn ich die niederschwellig in Gespräche einbeziehen kann, dabei aber den Gesprächsrahmen verlasse? All das erfordert eine Reihe von pädagogischen Entscheidungen und neue Settings.
Wie sich Gespräche verändern, ist die Perspektive von der etablierten Pädagogik aus in eine Pädagogik mit digitaler Technik. Wichtig bleibt, sich daran zu erinnern, dass Pädagogik erstens nie technikfrei war und zweitens nicht so tun kann, als würde es die digitalen Verfahren nicht geben: Auch Ignorieren ist eine Verhaltensweise, ist eine Entscheidung, ist eine Reaktion auf die Herausforderung der Technik.
Die andere Perspektive ist die von digitalen Settings auf die Pädagogik. Letztes Jahr habe ich an der Uni Frankfurt darüber gesprochen, wie Pädagogik in Computerspielen funktioniert.
Dabei habe ich den Onboarding-Prozess angeschaut: Das ist die Phase eines Spiels, in der erklärt wird, wie das Spiel funktioniert, wie es bedient wird, was Erfolgskriterien sind. In den 35 Jahren, welche die oben dargestellten Schulsituationen trennen, sind die Bedienungsanleitungen komplett weggefallen: Ein Spiel beginnt das Onboarding mit einer Spielsituation, in der Novizinnen und Novizen bereits handeln können. Sie probieren in einem didaktisch reduzierten Setting aus, wie das Spiel funktioniert. Dabei wird eine kleine Geschichte erzählt, sie erhalten bereits Figuren oder Spielelemente, mit denen sie ihre Spielidentität und -narration verbinden können. Es ist, als würden Schulen am ersten Schultag einfach mit einer Schulstunde beginnen, die Spaß und Lust auf mehr macht, statt zu erklären, wie Schule funktioniert, Hefte und Bücher auszuteilen, ein Konzert und Ansprachen abzuhalten.
Dieses Game-Onboarding ist aus Daten entstanden: Wer heute im Computerspielmarkt aktiv ist, weiß, wer das Spiel wie lange spielt; wer bereit ist, für Spielelemente zu zahlen; wer das Spiel einmal lädt, öffnet – und es dann nie wieder spielt. Aus diesen Daten sind pädagogische Einsichten entstanden, die den Umgang mit digitalen Artefakten heute prägen.
Der Effekt dieser digital gesteuerten Lernprozesse ist eine Veränderung der Aufmerksamkeitsstruktur. Apps rufen mit Push-Meldungen dazu auf, sie zu öffnen, auf digitale Ereignisse zu reagieren. Serien erlauben es, Intros zu überspringen (#skipintro). Sich wiederholende Abläufe können mit Assistenzprogrammen automatisiert werden. Wer viel Zeit mit digitalen Medien verbringt, nimmt Schule anders wahr: Braucht auch das Push-Nachrichten, möchte Einführungen überspringen oder Repetition automatisieren.
Daran lässt sich sehen, dass eine Weiterentwicklung der Pädagogik von zwei Seiten her angestoßen wird: Schulen antworten mit einer Evolution auf den Einbezug digitaler Technik in Unterrichtssettings – und Plattformen entwickeln pädagogische Konzepte, um Userinnen und User bei der Stange zu halten.
Sie bieten etwas an, was ich »personalisierte Bildung« nenne – es ist ein Bildungsangebot, das persönlich wirkt, es aber nicht ist. Es basiert auf den Daten, die ich auf der Plattform hinterlege, passt also so zu mir – nimmt mich aber nicht als Mensch wahr. Resultat ist eine Uber-Pädagogik: Wer für Uber fährt, befolgt Anweisungen eines Programms. Welche Kunden wohin befördert werden, welcher Weg eingeschlagen wird, wie viel eine Fahrt kostet – alles wird von Algorithmen errechnet. Wer Uber nutzt, wird getrackt – wer sich nicht konform verhält, wird bestraft und in Rankings herabgesetzt.

Nicht alle aus digitalen Plattformen resultierenden Settings funktionieren gleich – aber die Uber-Pädagogik nimmt die Befürchtung Anders‘ auf: »Was zählt, ist die Tendenz. Und deren Parole heißt eben: ‹ohne uns›.« (a.a.O.) Uber braucht Menschen noch als Kundinnen/Kunden und für Handlungen, die Maschinen noch nicht ausführen können. Menschen sind aber grundsätzlich auf beiden Seiten ersetzbar.
Kathrin Passig hat in ihren Überlegungen zu digitalen Verfahren bei der Literaturproduktion eine harmlosere Lesart dieser Pädagogik vorgelegt. Uber kann auch als eine »Zusammenarbeit mit Maschinen« verstanden werden. Wie eine Taxi-Fahrerin halt immer mit einem Auto zusammenarbeitet, arbeitet sie neu mit einem Auto und einer App:
Die Zusammenarbeit mit Maschinen unterscheidet sich nicht so sehr von der Zusammenarbeit mit anderen Menschen, und die Zusammenarbeit mit anderen Menschen unterscheidet sich nicht so sehr von der Zusammenarbeit mit dem eigenen Kopf.
– Kathrin Passig, Vielleicht ist das neu und erfreulich, 2019
Die pessimistischere Ansicht wäre: Noch arbeitet die Taxi-Fahrerin, bald nicht mehr. Es ginge auch ohne sie. Hier stellt sich die Frage, was das Ziel von Pädagogik ist. Geht es darum, Abläufe zu optimieren – oder um Menschen zu begleiten?
In Dietrich Benners Einführung in die Pädagogik von 2001 gibt es eine Bestimmung der pädagogischen Praxis als Spannung zwischen Unfertigkeit und Vollendung:
»Eine Tätigkeit kann dann als Praxis bezeichnet werden, wenn sie erstens in einer Imperfektheit oder Not des Menschen ihren Ursprung hat, diese Not wendet, die Imperfektheit selbst aber nicht aufhebt, und wenn zweitens der Mensch durch sie eine Bestimmung erlangt, welche nicht unmittelbar aus der Imperfektheit folgt, sondern durch seine Tätigkeit allererst hervorgebracht wird.«
Eine pädagogische Antwort auf die digitale Transformation hebt die Imperfektheit des Menschen nicht auf, während eine digitale Antwort auf pädagogische Fragen die Tendenz haben kann, das zu tun. Erst dann wird die Befürchtung Anders‘ aktuell, Technik würden den Menschen obsolet machen.
Das SAMR-Modell im pädagogisch-technischen Kontext
Das SAMR-Modell von Puentedura (2006) widmet sich der Frage, was passiert, wenn »Lerntechnologie« an Schulen eingesetzt wird. Wie wir gesehen haben, ist diese Frage sehr künstlich: Es gibt kein Unterrichtssetting ohne Technologie, weil auch Stifte, Hefte, Bücher zur Technik gehren. Präziser wäre die Frage danach, wie digitale Lerntechnologie »intergriert« wird.
Puenteduras These besagt, dass in einem ersten Schritt der Versuch erfolgt, bekannte Methoden zu ersetzen: Arbeitsblätter werden zu digitalen Arbeitsblättern, Prüfungen zu digitalen Prüfungen, Lehrvorträge zu Erklärvideos. Die Substitution schöpft aber die Möglichkeiten nach dem Leitmedienwechsel nicht aus – und so müssen neue Aufgaben und Methoden entstehen. Social Reading, kollaboratives Schreiben, Lernen mit digitalen Modellen, umfassende Kooperation bezeichnen das von der Substitution entfernte Szenario.

Axel Krommer hat ausführlich gezeigt, dass es keine Substitution gibt und geben kann. Gleichwohl scheint mir die These von Puentedura einen Wert zu haben: Sie zeigt, dass die Möglichkeiten digitaler Technik an Schulen zuerst zögerlich und in bereits bekannten Denkmustern genutzt werden – und erst später und erst bei der Benutzung deutlich wird, welche neue Lern- und Unterrichtsformen durch die Technik erschlossen werden. In diesem Sinne gilt nicht »Pädagogik vor Technik«, sondern »Technik vor (anderer) Technik« und »Pädagogik vor (anderer) Pädagogik«. Erst durch die Praxis verändert sich die Praxis.
Ein Modell für pädagogische Entscheidungen in der Kultur der Digitalität
Die hier vorgelegten Überlegungen zeigen, dass die Vorstellung, pädagogische Entscheidungen könnten unabhängig von technischen (oder vor technischen) gefällt werden, naiv ist. Damit können Schulen und die Bildungspolitik den Herausforderungen der digitalen Transformation nicht begegnen.
Aber wie gelingt ihnen das? Gerhard Brandhofer hat eine zweistufige Antwort auf diese Fragen vorgelegt:
»Stufe 1 in diesem Konzept umfasst die Klärung, welche Kriterien wir für die Bewertung von Unterricht heranziehen wollen. Es ist also zu erarbeiten, was Kennzeichen und Bewertungskriterien wirkmächtiger Didaktik sind. Solche Kriterienkataloge sind per se immer subjektiv. Zielführend im Sinne des kritischen Rationalismus wäre daher die Konstruktion eines Kriterienkataloges, der einer ständigen kritischen Überprüfung und Infragestellung unterzogen wird.
In einer zweiten Phase wären Methoden, Medien und Applikationen an diesem Kriterienkatalog zu messen, um entscheiden zu können, ob sie im Unterricht zum Einsatz kommen sollen. Auch hier soll das Prinzip der kritischen Prüfung zur Anwendung kommen, was bedeutet, dass die Bewertung immer nur eine vorläufige sein kann.«
Diese Antwort ist deshalb tauglich, weil sie in Schlaufen oder Spiralen denkt und Entscheidungen jeweils provisorisch vornimmt. Genau sind die Bewegungen »Pädagogik vor Pädagogik« und »Technik vor Technik« zu denken: Stufe 1 fragt, wie sinnvolles pädagogisches Handeln gestaltet werden soll. Stufe 2 bezieht Technik als einen Aspekt eines Unterrichtssettings mit ein. Bevor ich das weiter kommentiere, möchte ich kurz darlegen, wie das in meinem Unterricht funktioniert:
Ich denke darüber nach, was die Schülerinnen einer Klasse in der nächsten Einheit lernen könnte oder sollte – und wie das gelingen könnte. In diese Überlegungen fließen vergangene Erfahrungen, Feedback und Reflexionen der Klasse mit ein. Ich merke so also beispielsweise, dass eine Klasse sicherer im Schreiben von Sachtexten werden sollte. Daraus ergeben sich automatisch Kriterien für die folgende Unterrichtseinheit: Die Schülerinnen und Schüler sollten viel schreiben, Einsichten dazu gewinnen, ihr eigenes Schreibverhalten reflektieren und generell besser schreiben können.
Dann wähle ich bestimmte didaktische Settings aus, zu denen immer auch digitale Arbeitsformen gehören. Ich überlege etwa, welche Assistenztools im Netz (eine Liste habe ich hier festgehalten) Schreibprozesse stützen könnten, wie Peer-Feedback im Netz funktionieren könnte, wie digitale Aufgaben Verbindlichkeit herstellen könnten.
Schreiben mit digitalen Hilfsmitteln ist komplexer, aber in vielerlei Hinsicht auch effizienter. Das muss pädagogisch und didaktisch reflektiert werden. Aus den Entscheidungen in beiden Stufen gewinne ich weitere Erkenntnisse, die mir dabei helfen, eine nächste Unterrichtseinheit zu planen. Oft verändern sich die Funktionsweise digitaler Hilfsmittel, nächstes Jahr haben meine Klassen statt eines Smartphones einen Laptop dabei – generell findet mein Unterricht in einer sehr dynamischen Umgebung statt. Deshalb ist es wichtig, Entscheidungen nicht starr zu lassen, sondern sie provisorisch zu fällen und sie regelmäßig zu prüfen.
Und das ist das Ergebnis dieser Überlegungen: Pädagogik in einer Kultur der Digitalität berücksichtigt, dass Technik verspricht, die Effizienz von Handlungen zu steigern – dabei aber zu einer Komplexitätssteigerung führt. Dieser Herausforderung muss wiederum pädagogisch begegnet werden: Nicht durch eine Trennung von Pädagogik und Technik, sondern durch das Herstellen von Bezügen und Reflexion aus beiden Perspektiven.
Verwendete Literatur
Anders, Günther (2003): Die Frist. In: Ders. Die atomare Drohung. Radikale Überlegungen zum atomaren Zeitalter. München: Beck: 170–221.
Arendt, Hannah: Schalentier-Zitat nach Gehlen, in: Bergedorfer Gesprächskreis 9 [pdf]
Benner, Dietrich (2001): Allgemeine Pädagogik. Weinheim: Juventa.
Brandhofer, Gerhard (2019): Das Modell einer zweistufigen kritischen Prüfung für eine wirkmächtige Didaktik. [pdf]
Briddle, James (2014): The Algorithm Method. In: The Guardian. [Link]
Krommer, Axel (2018): Wie ein Common-Sense-Medienbegriff zu pädagogischen Fehlschlüssen führt. [Link]
Krommer, Axel (2019): Warum der Gegensatz »Pädagogik vor Technik« bestenfalls trivial ist. In: Routenplaner Digitale Bildung. [Link]
Passig, Kathrin (2019): Vielleicht ist das neu und erfreulich. Droschl Literaturverlag.
Stalder, Felix (2019): Herausforderungen der Digitalität jenseits der Technologie (Link)
Wampfler, Philippe (2018): Wie verändert sich Aufmerksamkeit durch digitale Kommunikation (Link)
Zierer, Klaus (2017): Lernen 4.0. Pädagogik vor Technik. Möglichkeiten und Grenzen einer Digitalisierung im Bildungsbereich. Schneider Verlag.
grrr. Mein Kommentar ist weg.
Also nochmal in Ultrakurzfassung ein paar Gedanken:
1. ich habe größte Probleme damit, den Medienbegriff auf den Technikbegriff runterzureduzieren, gerade wenn es um Pädaogik geht, eines der Subsysteme von Gesellschaft
2. Wenn dann die Fkt auch noch auf Effizienz runterreduziert wird, wird es noch schwieriger, eine systemische Betrachtung überhaupt noch in ‚Betracht zu ziehen
3. Eine Fokussierung – und ohne Einbettung in gesellschaftlichen Gesamtzusammenhang! – auf zwei Komponenten/Aspekte als Untersuchung von Zusammenhang, nämlich auf Technik & Pädagogik, das kann nicht gut gehen (bzw. ist für einen Komplexitätsdenker eigentlich ein no-go.)
4. Diese Dreifachreduzierung ist m.E. insgesamt ein Rezept für toolification – obwohl anderweitig intendiert.
5. Die Komplexitätszunahme der Gesellschaftlichkeit durch eine höhere Stufe der Medialität (oder meinetwegen IK-Technologie) muss ja zum Zwecke, damit umgehen zu können, d.h. der Reduktion der äußeren Komplexität, mit einer Erhöhung der inneren Komplexität einhergehen: Das heißt für psychische Systeme: höhere Bewusstseinstätigkeit/Denkfähigkeit – das wäre, was ich „Literacy 2 für Alle“ nenne oder „Jeder muss Intellektueller werden“ – bzw. für das Subsystem Bildung muss es heißen, seine innere Struktur zu komplexifizieren, konkret z.B. blended learning aufzunehmen, und die Literacy 2 für Alle aufs tapet zu setzen.
6. Wenn Systemtheorie nicht deine favorisierte Komplexitätstheorie ist, dann würde ich auch gerne alles in die andere übersetzen, namely in dialektischen Materialismus. Aber nicht jetzt
Sorry, habe den Kommentar erst jetzt gesehen. Mein Eindruck ist nicht, dass ich Komplexitätsreduktion betrieben hätte – ich habe einfach einen Zusammenhang diskutiert. Aber ich denke über deine Einwände und Anmerkungen genr noch mal nach.
Ich habe dir nicht Komplexitätsreduktion, sondern Simplifizierung vorgeworfen. Das eben ist etwas anderes.